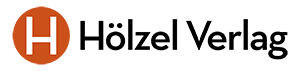Schwerpunkt
„Die Lehrerinnen und Lehrer machen das richtig gut!“
Welche Chancen aus Irrtümern erwachsen, warum falsch schon lange nicht mehr schlecht ist und was das alles mit einem Bermudadreieck zu tun hat: Ein Gespräch mit Fehlerforscherin Eveline Wuttke.
Das Gespräch führte Stefan Schlögl - 5. Juni 2019
Einer Ihrer Schwerpunkte ist das Lernen aus Fehlern. Wer lernt da was?
Bei unseren Forschungen geht es vor allem darum, was Lehrpersonen fachlich und didaktisch grundsätzlich können müssen, damit Schülerinnen und Schüler aus ihren Fehlern lernen. Es gibt ja das Klischee „Aus Fehlern wird man klug“, aber das ist kein Automatismus.
Wenn ein Kind auf eine heiße Herdplatte greift, dann lernt es hoffentlich sofort, dass das nicht gut ist. Die Rückmeldung ist ja unmittelbar.
In der Schule hingegen, speziell im Rechnungswesen, einem Schulfach, das wir intensiv beforscht haben, lernt man aber eben nicht automatisch aus Fehlern.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Das wäre etwa eine Situation, die der Fehlerforscher Fritz Oser das Bermudadreieck der Unterrichtsinteraktion bezeichnet. Dabei stellt die Lehrperson einem Schüler eine Frage, die von ihm falsch oder nicht ganz richtig beantwortet wird, und der Lehrer gibt die Frage kommentarlos weiter.
Wenn dann irgendwann von einem anderen Schüler die richtige Antwort kommt, sitzt der erste Schüler da und weiß nur: Irgendwas hab ich falsch gemacht, aber nicht, was genau – und vor allem weiß er nicht, wie er es in Zukunft besser machen kann.
Beobachten Sie diese vergebenen Lernchancen öfter?
Es gibt natürlich Flüchtigkeitsfehler, die Schülern unterlaufen. Da muss ein Lehrer vermutlich nicht lange in die Analyse gehen. Wenn es aber erkennbare Fehlkonzepte gibt, Schüler also tatsächlich ein grundlegendes Miss- oder Nichtverständnis zeigen, sollte die Lehrperson etwas tun.
„Auch bei typischen Fehlern hilft Nachfragen, um Denkfehler zu identifizieren.“
Und dabei ist deren Fachkompetenz die mit Abstand wichtigste Variable für Lernerfolg bei Schülerinnen und Schülern. Die zweite ist fachdidaktisches Wissen, also wie reagiere ich auf Fehler, damit das Potenzial gehoben wird, daraus zu lernen.
Wie sollten Lehrer richtig reagieren, wenn sie Fehler bemerken?
Zuerst einmal nachfragen. Etwa: „Wie kommst du auf diese Lösung?“ Sonst kann man ja nicht nachvollziehen, was genau passiert ist. Das machen Lehrpersonen leider sehr selten.
Dazu muss man aber sagen, dass erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen bereits wissen, wann und oft auch weshalb typische Fehler passieren. Aber auch hier würde Nachfragen helfen, Denkfehler zu identifizieren.
Im Rechnungswesen etwa gibt es ja verschiedene Aspekte: Die Buchungssystematik sollte beherrscht werden, es muss also korrekt verbucht werden.
Aber es geht auch darum, die hinter einem Buchungssatz liegenden ökonomischen Prozesse zu verstehen. Und gerade dieses Verständnis kommt im Unterricht häufig zu kurz.
Niemand zeigt gerne, dass er falsch liegt, einfach nicht mitkommt. Wie gelingt es, dass die an die Klasse gestellte Frage „Haben das jetzt alle verstanden?“ nicht reaktionslos im Raum verpufft?
Das hängt vor allem von den Signalen ab, die eine Lehrperson während des Unterrichts aussendet. Indem sie zeigt, dass Fehler nützlich sind, dass man daraus lernen kann, und das wechselseitig.
„Als Lehrer sollte man zeigen: Es gibt hier einen Freiraum, Warum-Fragen sind ausdrücklich erwünscht.“
Wenn Schüler hingegen merken, dass ein „Ich verstehe das jetzt nicht!“ als störend empfunden wird, meldet sich natürlich niemand. Das hat auch etwas mit der Einstellung dieser Lehrer gegenüber Fehlern zu tun.
Meist führen sie ihren Unterricht sehr eng, damit die vermeintlichen Störungen gar nicht erst möglich sind. Stattdessen sollte man zeigen: Warum-Fragen sind ausdrücklich erwünscht, es gibt hier einen Freiraum, um Fehler zu machen oder Lösungswege zu diskutieren.
Mittlerweile wird auch mit neuen Lernmethoden gearbeitet, Lernbüros etwa oder offener Unterricht. Doch spätestens bei der schriftlichen Prüfung regiert meist wieder der Rotstift. Ein Widerspruch?
Auf den ersten Blick ist das natürlich ein Widerspruch. Man lässt Schüler eigenständig lernen und erwartet dann in der Prüfung die einzig richtige Lösung.
Aber dieses Dilemma lässt sich zumindest abmildern, wenn man alternative Methoden der Leistungsmessung etabliert. Und das kommt mittlerweile auch an den Schulen an.
Schließlich sollten vor allem in der Berufsausbildung authentische, berufsrelevante Prüfungssituationen geschaffen werden.
Auch bei Abschlussprüfungen wie der Matura?
Auch hier wäre es wünschenswert, wenn verstärkt praxisnahe Aufgaben gelöst werden. Wobei dann aber auch klar ist, dass es nicht die eine einzige gültige Lösung gibt.
„Manchmal gibt es keine eindeutigen Lösungen, es zählen vor allem die Begründungen.“
Wenn etwa eine Prüfungsaufgabe die Beschaffung aller Teile für den Bau von Fahrrädern behandelt, berührt das unterschiedliche Kenntnisse: ökonomische Aspekte natürlich, aber auch ökologische, qualitative und so weiter.
Da gibt es keine eindeutige Lösung, hier zählen Begründungen, die dann aber auch gegeben werden müssen.
Im Rechnungswesen gibt es aber noch immer ein Richtig oder Falsch.
Aber selbst da gibt es Variablen. Wie setze ich zum Beispiel den Wert bestimmter Güter an? Aber natürlich sind die Aufgaben hier eindeutiger bewertbar und lassen sich entsprechend benoten.
Dem eigentlichen Fehler geht ja oft die Angst davor voraus. Die kann ja von vielen Seiten verstärkt werden: vom Lehrer, von den Eltern, den eigenen hoch gesteckten Zielen. Was tun?
Das ist vor allem eine Frage des Unterrichtsklimas und der Fehlerkultur. Da kann man bereits im Vorfeld sehr viel Angst abbauen. Wobei ich an dieser Stelle eine Lanze für die Lehrer brechen muss.
Es hat sich bei unseren Forschungen durchgängig gezeigt, dass es mittlerweile für so gut wie alle Lehrenden selbstverständlich ist, ein produktives, angstfreies Umfeld aufzubauen. Das machen sie richtig gut!
Und ganz grundsätzlich ist eine gewisse Nervosität vor Prüfungen normal, sie steigert sogar die Konzentration. Diese Anspannung gehört einfach dazu – und ist gewiss kein persönlicher Makel.
Es ist ja immer von Fehlerkultur die Rede, nicht zuletzt in der Berufswelt. Manchmal hat man den Eindruck, als wäre der Begriff bloß ein Feigenblatt.
In den Schulen hat sich viel zum Positiven verändert. Natürlich ließe sich trefflich diskutieren, was diese Fehlerkultur nun tatsächlich sei.
„Noch immer gibt es die Neigung, Fehlleistungen zuerst einmal zu tabuisieren.“
Doch all unsere Studien belegen, dass sich das Lernklima zum Positiven verändert hat. Früher war das oft anders, da hieß es: Falsch ist schlecht. Aber das gilt schon lange nicht mehr.
In vielen Unternehmen gibt es zwar schon lange eine sehr präzise Fehleranalyse, aber wie dann mit einem Problem umgegangen wird, hängt noch immer von der jeweiligen Unternehmenskultur ab.
Wenn man sich den Umgang großer Konzerne mit dem Diesel-Skandal ansieht, gibt es leider noch immer die Neigung, Fehlleistungen zuerst einmal zu tabuisieren oder wegzudiskutieren.
In vielen US-amerikanischen Firmen wird viel offensiver damit umgegangen, manche veröffentlichen sogar Berichte, in denen sie zeigen, was misslungen ist. Ist so ein Umgang auch in Deutschland oder Österreich vorstellbar, Länder, die sich mit dieser Transparenz traditionell schwer tun?
Es ist immer gut, wenn ein Unternehmen seine Fehlleistungen, zumindest intern, transparent macht. Das ist nichts anderes als das Schaffen eines positiven Fehlerklimas. Frei nach dem Motto: Das passiert, aber wir haben auch daraus gelernt.
Und das stärkt auch das Vertrauen der Arbeitnehmer. Meines Erachtens kommt das auch auf die jeweilige Branche an. Bei Start-ups oder im Non-Profit-Bereich etwa bin ich überzeugt, dass wir diese Offenheit auch in Europa hinbekommen.
Apropos Offenheit: Was war Ihr letzter Fehler – und was haben Sie daraus gelernt?
Der wurde mir gerade erst präsentiert. Ich habe mit einer Kollegin einen Forschungsantrag für eine Studie eingereicht, an dem wir sehr, sehr intensiv gearbeitet haben.
Doch trotz aller Sorgfalt ist es uns glatt passiert, eine nicht nachvollziehbare Hypothese einzubauen. Und das ist dem potenziellen Fördergeber, obwohl fachlich sonst alles korrekt war, aufgefallen.
Was ich daraus gelernt habe? Noch genauer zu recherchieren. Erfreulicherweise ist der Fördergeber überaus fehlertolerant. Wir erhalten eine zweite Chance.
Zur Person
 Dr. Eveline Wuttke ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität
in Frankfurt am Main.
Dr. Eveline Wuttke ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität
in Frankfurt am Main.
Zu ihren Forschungsgebieten gehören neben Lernen aus Fehlern u. a. berufliche Lehr-Lern-Forschung, Kompetenzen von Lehrkräften sowie Ursachen und Auswirkungen von Langeweile im Unterricht.
Mehr zum Thema Fehlerkultur
Interview: „Panik ist fehl am Platz“
Interview: „Es ist schlecht, wenn die Angst mitspielt“
Aus der Praxis: Mehr Mut zum Denken
Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 1/19.