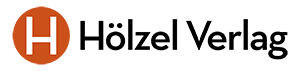Schwerpunkt: Vertrauen
Beziehungsarbeit: So geht Vertrauen auf Chinesisch
Die Unternehmensberaterin Barbara Scharrer über die Kunst, im Reich der Mitte Vertrauen aufzubauen – und die Gründe, warum sich chinesische Chefs niemals die Hände schmutzig machen würden.
Das Gespräch führte Nina Horcher - 11. April 2018
Vor kurzem war wieder eine Delegation österreichischer Spitzenrepräsentanten in China. Aufträge im Wert von 1,5 Milliarden Euro wurden an Land gezogen. Sie beraten seit über 20 Jahren Firmen aus dem deutschen Sprachraum bei ihrer Arbeit im chinesischen Markt. Worauf müssen Unternehmer oder Arbeitnehmer achten, wenn sie in China erfolgreich sein wollen?
Es gibt jede Menge Kulturunterschiede, die sich auf Unternehmen und Menschen auswirken. Man muss sich an die chinesische Gesellschaft anpassen – im Kommunikationsstil, im Führungsmanagement und auch in der persönlichen Erwartungshaltung.
Kann man Vertrauen von chinesischen Mitarbeitern oder Chefs überhaupt voraussetzen?
Wenn man es richtig macht, ja. Man muss aber den großen Kulturunterschied verstehen. In China leben die Menschen nach dem „Guanxi-Prinzip“. Das bedeutet: Jeder verfügt über ein Netzwerk sozialer Beziehungen und innerhalb dieser sogenannten Ingroup wird den Menschen sehr viel Vertrauen entgegen gebracht.
Dieses Vertrauen genießen sogar Unbekannte, die Freunde von Freunden sind. Man kann sich das wie eine Zwiebel vorstellen. Diese kollektivistische Kultur ist noch ein Erbe des chinesischen Kaiserreichs. Bis heute ist jeder extrem von seinem Netzwerk abhängig.
Dadurch haben Chinesen auch andere Moralvorstellungen. Wer nicht in dieser Ingroup ist, dem wird teilweise keinerlei Hilfe angeboten. In Großstädten, wo alle anonym leben, kann dieses Kulturkonzept schwierig sein, etwa wenn bei Verkehrsunfällen niemand helfen will.
„Chinesen sehen Zeit als einen Kreislauf. Als etwas, das immer da ist.“
Wie schafft es jemand, der aus Österreich auf den chinesischen Markt entsandt wird, in so ein Netzwerk aufgenommen zu werden?
Es braucht eine gute Vorbereitung. Als Arbeitnehmer ist es etwas leichter als aus Unternehmersicht. Wichtig ist, diese kulturellen Strukturen zu kennen. Auch zwischenmenschlich gelten andere Regeln als in Europa.
Zum Beispiel Blickkontakt: In China schaut man einer Respektsperson, wie es ein Arbeitgeber ist, nicht direkt in die Augen. Auch nicht beim Bewerbungsgespräch. Dieses Verhalten wird als höflich empfunden, was bei uns eine gegenteilige Bedeutung hätte. Es gilt etwas als höflich, das bei uns überhaupt nicht gehen würde. Diese nonverbale Kommunikation ist sehr wichtig, um eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Welche zusätzlichen Herausforderungen gibt es für einen Unternehmer, der sich in China einen neuen Standort aufbauen will?
Neben dem Zwischenmenschlichen ist für chinesische Arbeitnehmer Prestige und Reputation sehr wichtig. Wenn Sie mit ihrem Unternehmen erfolgreich sein wollen, empfiehlt es sich, einen schicken Bürotower als Niederlassung zu wählen.
Die neueste Technik und eine schöne Büroeinrichtung dürfen auch nicht fehlen. Chinesen wollen stolz sein auf ihren Arbeitgeber, weil sie sich laufend mit anderen Menschen in ihrem Netzwerk vergleichen.
Auch die zeitliche Perspektive ist eine andere: In China leben die Menschen polychrom. Das heißt, sie sehen Zeit als einen Kreislauf, als etwas, das immer da ist. Wenn es um Deadlines geht, ist das nicht gerade förderlich.
Deswegen dürfen Chefs aber auch mehr kontrollieren. Es wird hier ein viel intensiveres Führungsverhalten gefordert als in Europa. Kontrolle und Aufmerksamkeit wird als positiv wahrgenommen.
„Ein Chef wird sich nie die Hände schmutzig machen.“
Es gibt also eine klare Erwartungshaltung, wie der Chef das Unternehmen und die Mitarbeiter führen soll?
Ja, Hierarchien und Status sind sehr wichtig. Wenn etwa ein Fabrikarbeiter zum Leiter befördert wird, wird er sich nie wieder die Hände schmutzig machen. Auch dann nicht, wenn er der Einzige ist, der eine Maschine reparieren kann. Er hätte Angst, den Respekt der Mitarbeiter zu verlieren. Gleichzeitig steht aber auch der Teamgeist über allem.
Es gibt ein Beispiel, mit dem ich das meinen Studenten gerne veranschauliche: Stellen Sie sich einen Fischschwarm vor. Vor dem Schwarm schwimmt ein einzelner Fisch. Fragt man Europäer, welche Rolle der eine Fisch hat, werden sie ihn ziemlich sicher als Anführer definieren. In China ist es genau anders: Der einsame Fisch wird als Outsider gesehen, als jemand, der zu keinem Netzwerk gehört.
Der wahre Anführer schwimmt im Schwarm mit. Es gibt zwar die klare Rollenverteilung, aber auch die funktioniert nur, wenn man gemeinsam in einem Team arbeitet. Chinesen lernen schon in der Schule, dass sie immer nur als Teil einer Gruppe funktionieren.
Wenn man sich in einer Situation falsch verhält, wird einem das Vertrauen also gleich wieder entzogen?
In einer hohen Position sollte man schon aufmerksam sein. So streng sind die Chinesen allgemein aber nicht. In der Regel sind die Menschen sehr offen und wenn man ihnen mit Respekt begegnet, werden Fettnäpfchen auch verziehen. Manchmal sind solche Fauxpas auch gut, um in Kontakt zu treten und in ein Netzwerk aufgenommen zu werden.
Wir Europäer trennen oft zwischen Berufs- und Privatleben, das ist in China nicht so. Die Menschen wollen ihre Ingroup ständig erweitern und haben dann aber auch tiefere Verbindungen.
„Teamwork ist für Chinesen schwierig, weil sie sehr kompetitiv erzogen werden.“
Spiegelt sich dieser Kollektivismus auch im chinesischen Schulsystem wieder?
In China stehen nicht die Schüler im Mittelpunkt, sondern die Lehrer. Das ist natürlich nicht unbedingt positiv. Schule in China ist nicht per se dazu da, die individuellen Stärken eines jeden Schülers kreativ zu fördern, sondern – neben der Wissensvermittlung – geht es vor allem darum, den Schülern die Gesetze des richtigen kollektivistischen Gruppenverhaltens, also das „Guanxi-Prinzip“, zu lehren.
Einerseits gibt es einen großen Wettbewerb zwischen den Schülern, jeder will der allerbeste sein, auch aufgrund des großen Drucks der Eltern, andererseits vermeidet es ein Schüler, aus der Gruppe herauszustechen, denn dann könnte er zu dem einsamen Fisch werden. Dadurch ist Teamwork für chinesische Arbeitnehmer auch schwierig, sie sind sehr kompetitiv erzogen.
Was können Schülerinnen und Schüler von diesen Erfahrungen mitnehmen?
Das Wichtigste und auch Spannendste ist meiner Meinung nach Selbstreflexion. Die Scheuklappen ablegen und schauen, wie man selbst von der eigenen Kultur geprägt ist und zu welchem Menschen man dadurch wird. Offen sein für Neues und unvoreingenommen handeln. Dann findet man sich auch in anderen Kulturen zurecht.
Zur Person:

Barbara Scharrer ist Rechtsanwältin, Aufsichtsrätin und Universitätsdozentin für Internationales Management Asien an der Universität Würzburg und der Hochschule für angewandtes Management München-Erding.
Die 48-Jährige hat über 20 Jahre Erfahrung in Strategie- und Rechtsberatung deutschsprachiger Unternehmen in China und hat das Asien-Geschäft einer globalen Beratungsgesellschaft aufgebaut und geleitet.
Vertrauensforscher im Interview: „Das ist eine Investition, die sich immer rechnet“
Nachgefragt: Was Schüler und Lehrer zusammenhält
Aus der Praxis: Vier Lehrerinnen und Lehrer erzählen
Ein Beitrag der Was jetzt Online-Redaktion.