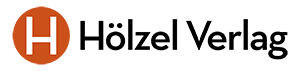Schwerpunkt: Vertrauen
Vom Mut, Vertrauen zu wagen
Gegenseitiges Vertrauen ist einer der wichtigsten Antriebsriemen unserer Gesellschaft. Doch woher kommt es? Wie wird man vertrauenswürdig? Und warum ist diese Haltung gerade heute so wichtig?
Ein Essay von Stefan Schlögl - 8. März 2018
Braune Augen sind gut, blaue Augen weniger. Intelligenz schadet nicht, genauso wenig wie eine grundsätzlich optimistische Einstellung zum Dasein. Dazu noch einen Schuss des Hormons Oxytocin in den Drink des Gegenübers – und schon sind Sie das personifizierte Vertrauen.
Es ist, zieht man Studienergebnisse aus der einschlägigen Forschung zurate, also ziemlich einfach, Vertrauen herzustellen und als vertrauenswürdig zu gelten. Tatsächlich aber ist dieses Gefühl, diese Haltung zum Leben eine gefährdete Spezies. Überall, so scheint es, ist von einer „Vertrauenskrise“ die Rede, sind einst als ehern bezeichnete Institutionen wie Politik, Kirche, Medien, ja auch Schule dem Verdacht ausgesetzt, das in sie gesetzte Vertrauen nicht einzulösen, gar zu missbrauchen.
Ein Gift namens „Fake News“
Misstrauisch werden seit der Finanzkrise Banken und multinationale Konzerne beäugt, das Vertrauen in Informationen, Nachrichten, Journalisten, die Medien an sich, hat heftig Schlagseite bekommen. Stattdessen träufelt ein Gift namens „Fake News“ in die sozialen Kanäle. Nicht zuletzt in der Politik ist allenthalben von „Vertrauensbruch“ des Koalitionspartners, des (ehemaligen) Parteikollegen etc. die Rede.

Gleichzeitig wird das V-Wort in schöner Regelmäßigkeit abgefragt, beschworen, eingefordert – ganz gleich, ob beim Bäcker ums Eck, in der hohen Politik oder in der Liebe. Während der eine seine Semmeln mit dem Hinweis auf regionale Zutaten und dem Vertrauen auf Nachhaltigkeit und ehrliches Handwerk veredelt, werden Politiker in Umfragen regelmäßig per Vertrauensfrage vermessen.
Eine Erkundigung, die in abgewandelter Form nicht zuletzt über den Bestand, die Zukunft jeder Beziehung entscheidet. Vertraust du mir? Kann ich dir vertrauen? Vertrauen wir einander? Mehr Fragen bedarf es nicht, um den Wert einer Ehe, einer Freundschaft, einer beruflichen Partnerschaft oder das vielzitierte „Vertrauensverhältnis“ zwischen Eltern und ihren Kindern, Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern zu verorten.
Ein Schmiermittel unserer Gesellschaft
Vertrauen ist, so könnte man sagen, das Schmiermittel unserer Gesellschaft. Wer vertraut, schließt eine Wette auf die Zukunft ab und geht davon aus, dass sich eine Sache oder eine Vereinbarung wie versprochen bzw. erhofft entwickelt. Wo diese Übereinkunft fehlt, gibt es keine Verbindlichkeit, keine Verlässlichkeit, ist jede Beziehung, sei es beruflich oder privat – zum Scheitern verurteilt.
„Zu wenig und zu viel
Vertraun sind Nachbarskinder“,
wusste schon Wilhelm Busch.
Zu groß jedoch sollte der Glaube in das Gute auch wieder nicht sein. Vom nigerianischen Prinzen, der via E-Mail ein Vermögen verspricht, über den vom Urlaubshotel aus „perfekt erreichbaren“ Strand bis zum treuherzig blickenden Filius, der natürlich nichts anderes macht, als für die Prüfung zu büffeln, hält der Alltag genügend Anlässe für das vielzitierte gesunde Misstrauen bereit. „Zu wenig und zu viel Vertraun [sic] sind Nachbarskinder“, beschreibt Wilhelm Busch dieses ständige Ausbalancieren zwischen Optimismus und Skepsis.
Urvertrauen aus Kindheitserinnerungen
Warum jedoch dieser Vorschuss an Zuversicht, diese Überzeugung bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer ausgeprägt ist – darauf gibt es nicht die eine Antwort. Vielmehr hängt der Grad der Vertrauensseligkeit eines Menschen von unzähligen Faktoren ab – von der Situation etwa, von Vorurteilen, vom Informationsstand und Vorwissen.

Das Urvertrauen – gewissermaßen die Grundeinstellung, mit der wir unserer Umwelt begegnen – ist nichts anderes als erlerntes Verhalten, eine Erfahrung, die bis zu unserer Kindheit zurückreicht. Zwei Faktoren sind Psychologen zufolge für dessen Entwicklung verantwortlich: Selbstvertrauen, also die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten, sowie die Ausbildung eines Fremdvertrauens und damit die prinzipielle Gewissheit, sich auf Eltern, Geschwister, später Freundinnen/Freunde und Lehrer/innen verlassen zu können.
Im Mittelpunkt stehen Gefühle
Wer lernt, dass das eigene Können zu Erfolgserlebnissen führt, die durch Wiederholung bestätigt werden, wer früh erlebt, dass die Mitmenschen Vertrauen belohnen, immunisiert sich später gegen notorische Skepsis und Argwohn – beides Wesenszüge, die zwar die eigene, gefühlte Sicherheit gegenüber Neuem, Unbekanntem stärken, aber auch Kontakt, Austausch und Kooperation erschweren. Vertrauen erfordert die Bereitschaft, auf der Suche nach Gegenseitigkeit auch Risiken einzugehen, sich verletzbar zu machen. Es geht also vor allem um Gefühle.
Bis zum Anfang der Moderne
war dieses ominöse Vertrauen nichts,
was man großartig ausverhandelte.
Das war nicht immer so. Bis zum Anfang der Moderne war dieses ominöse Vertrauen nichts, was man großartig ausverhandelte, bestenfalls eine Haltung, die man seinem Gott oder dem Landesfürsten kraft dessen Status und Autorität entgegenbrachte.
Auch der heilige Stand der Ehe gründete sich zuallererst auf dem gegenseitigen Einvernehmen, dass jeder die ihm von Tradition und Kirche zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen habe. Treue, jenes Wort, aus dem sich der Begriff Vertrauen emanzipierte, wurde schlicht als Übereinkunft verstanden, die Ehepflichten getreulich zu erfüllen.
„Trau, schau, wem“
Vertrauen, das war in der Ständegesellschaft etwas, mit dem man vorsichtig hantierte. So führt im Jahr 1633 ein illustriertes Flugblatt mit dem Titel Traw/Schaw/Wem – eine warnende Redewendung, die als „Trau, schau, wem“ bis heute erhalten blieb – Klage über die Falschheit der Welt. Vor allem Krämer, Pfaffen und junge Maiden galten da als wenig vertrauenswürdig.
Auch als das Wort Mitte des 18. Jahrhunderts erstmals in einem deutschsprachigen Lexikon auftaucht, wird es bloß als Hoffnung, nicht als Gewissheit charakterisiert. Vielmehr wird dort darauf hingewiesen, dass jener „auf den man sein Vertrauen setzet, nicht nur könne, sondern auch wolle helfen“.

Erst als im Gefolge gesellschaftlicher Umbrüche die alten Autoritäten an Bedeutung verloren und Philosophie, Politik und technischer Fortschritt immer stärker das Individuum in den Mittelpunkt rücken ließen, begann sich der Begriff des Vertrauens zu wandeln.
In Theater und Literatur brachen im Gefolge des „Sturm und Drangs“ die großen Emotionen aus, Freundschaften und Ehen wurden nicht nur am gesellschaftlichen Profit gemessen, sondern gründeten auf Respekt, Wertschätzung und Vertrautheit.
Pädagogische Moden
Auch in der Pädagogik stand das autoritäre, gewissermaßen gefühllose Lehrer-Schüler-Verhältnis auf dem Prüfstand. Schließlich blieben Bildung und Unterricht nicht mehr allein den Wohlhabenden vorbehalten, Schulen wurden im 19. Jahrhundert zu einer sozialen Institution, deren Lehrer nicht zuletzt als Vertrauensbildner gefordert waren.
In den Schulen wurde nicht
nur gepaukt, sondern eifrig der
„Weg zum Herzen des Schülers“ gesucht.
Bis Prügelstrafe und „Pennalismus“ endgültig aus den Klassen verschwanden, sollte es zwar noch Jahrzehnte dauern, doch in den Schulen wurde nicht nur gepaukt, sondern eifrig der „Weg zum Herzen des Schülers“ gesucht.
„Je weniger man seinen Zöglingen Vertrauen zeigt, desto weniger lernen sie und desto weniger werden sie auch leisten“, befand einer der frühen Reformer. Gleichzeitig jedoch wurde schon damals vor zu großen Gefühlsinvestitionen gewarnt, das fördere bei den Eleven bloß „Schwärmerei und Nachgiebigkeit“.
Ganz gleich, wie viel Vertrauen die jeweiligen pädagogischen Moden und politischen Strömungen bis ins Heute herauf zuließen oder einforderten: Vertrauen ist mehr als nur ein vielfach verflochtenes Band zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und Institutionen.
Verbesserte Kompetenzen
Gerade heute, in einer Zeit, in der von allen Seiten, auf allen Kanälen das große Misstrauen ausgerufen wird, wird die Basis für eine Haltung gelegt, die in alle gesellschaftlichen Bereiche ausstrahlt, sei es ins Wirtschafts- und Berufsleben, in dem wir als Konsument/in, Anbieter/in und Arbeitskollege/kollegin vielfältige Vertrauensverhältnisse eingehen, sei es als Mediennutzer/in, die/der Fakten von Unwahrheiten scheidet, sei es als Partner/in in einer Beziehung, in der Kleinigkeiten das gegenseitige Vertrauen immer wieder auf den Prüfstand stellen, und sei es nicht zuletzt als Pädagogin/Pädagoge, der kraft Kompetenz, respektvollem und aufrichtigem Handeln eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen kann.
Denn gewiss ist im täglichen Unterricht bloß eines: Vertrauen stiftet nicht nur ein besseres, harmonischeres Verhältnis zwischen Lehrkräften und Lernenden, es verbessert – das zeigen unzählige Forschungen – auch deren Kompetenzen. Keine einzige Studie liefert indes einen Beleg, dass zu viel Zuversicht in das Können der Schüler/innen zu einem Leistungsabfall führt. Man kann also gar nicht genug ins Vertrauen vertrauen.
Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 1/18.
Mehr zum Thema Vertrauen: