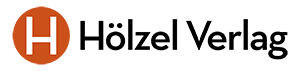Schwerpunkt: Medienkompetenz
Leo Hemetsberger: „Es gibt keine Privatsphäre im Internet“
Haben wir noch Geheimnisse im Internet? Nein, sagt Leo Hemetsberger von Saferinternet. Im Interview erklärt der Philosoph, was Lehrkräfte wissen sollen, um Jugendlichen digitale Achtsamkeit beizubringen.
Florian Wörgötter - 25. September 2020
Das Internet hat ein Elefantenhirn – es vergisst nichts. Daher ist es umso wichtiger, seine Informationen achtsam im Internet zu verbreiten. Der Philosoph Leo Hemetsberger beschäftigt sich seit den frühen 1990er-Jahren damit, wie wir auf unsere Privatsphäre im Internet achten können.
Als Mann der Praxis ist der Tiroler mit den Entwicklungen von Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok mitgewachsen. Als Experte von Saferinternet.at erklärt Hemetsberger auch Kindern und Jugendlichen, von der Volksschule bis zur HTL, wie sie ihre Achtsamkeit schulen können. Im Interview erzählt er, wie Lehrende mit Aufklärung und Information die Eigenkompetenz der Jugend unterstützen können.

Privatsphäre im Internet: Philosoph Leo Hemetsberger bringt Schülerinnen und Schülern digitale Achtsamkeit bei.
Was jetzt: Herr Hemetsberger, gibt es Privatsphäre im Internet?
Leo Hemetsberger: Nein. Die Privatsphäre ist das, was du nicht ins Internet stellst. Im Internet gibt es keine Geheimnisse.
Aber es muss doch auch im Netz möglich sein, seine Privatsphäre zu wahren.
In dem Moment, in dem du etwas postest oder über dein Handy verschickst, ist es nicht mehr privat. Natürlich kommt es darauf an, wie vertrauenswürdig dein Empfänger/innen(-Kreis) ist. Doch gerade in der Jugend liegen Liebe und Hass nahe beieinander. Auch dicke Freundschaften können zerbrechen und Klassengemeinschaften gehen auseinander. Dann liegen die eigenen Informationen auf dem Gerät der anderen.
„Digitale Achtsamkeit bedeutet: Verstehe deine Geräte, erkenne die Folgen und poste nur, was wirklich wichtig ist.“
Seine Privatsphäre währt man am besten, wenn man seinen digitalen Fußabdruck weitgehend reduziert. Und wenn man schon Dinge ins Internet stellt, sollte man die mittel- bis langfristigen Auswirkungen seiner Handlungen bedenken – was sowohl junge als auch erwachsene Menschen meistens nicht tun.
Wie erklärt man Jugendlichen, dass es wichtig ist, die Privatsphäre zu schützen?
Ich sage den Schülerinnen und Schülern immer: Ihr habt’s keine Ahnung, was wir in Eurem Alter alles aufgeführt haben – und Ihr werdet es auch nie erfahren, weil es damals weder Handy noch soziale Medien dokumentiert haben. Euer Blödsinn hingegen lässt sich im Internet leicht nachvollziehen. Auch wenn euch das heute Wurst ist, kann euch das in fünf oder zehn Jahren noch peinlich und unangenehm werden.
Verstehen das die 16-Jährigen?
Damit sie es noch besser verstehen, frage ich sie auch: Wer von euch möchte, dass eure Eltern eure Volksschulfotos ohne eure Zustimmung im Internet teilen? Das wollen sie natürlich nicht, weil sie jetzt ganz andere Personen sind. So verstehen sie auch, dass sie mit 25 Jahren vielleicht auch anders über die zweifelhaften Bilder ihrer Jugend denken.
Über welche Konsequenzen sollten Jugendliche informiert werden?
Schüler/innen müssen sich überlegen, was es für ihre Zukunft bedeutet, wenn sie online andere mobben, an fragwürdigen Challenges teilnehmen oder Nacktbilder verschicken. Die Konsequenzen solcher Aktionen können sein, dass potenzielle Arbeitgeber/innen darauf stoßen oder sie im Strafregister landen. Wie kürzlich veröffentlicht, prüft ein österreichisches Bankinstitut bei Kreditvergaben neben Ethnie und Gewerkschaftszugehörigkeit sogar den Facebook-Account.
Das Web 2.0 lebt davon, dass wir im Internet unser Privates mit anderen teilen. Für Jugendliche ist dieses Selbststilisieren Teil ihrer Identitätsbildung. Was sollen Schüler/innen denn im Internet preisgeben?
Ob Videoschnitt am Handy, witzige Filter oder Deep Fakes – die Interaktionsformate und Tools werden immer ausgereifter, aber im Grunde geht’s immer um das eine: Ich zeige etwas von mir her.
Bevor man etwas teilt, sollte man sich die Frage stellen: Wer soll das sehen können bzw. dürfen? Mein gesamter „Freundeskreis“, ein paar Freunde oder nur ein/e Freund/in? Wie möchte ich dargestellt werden? Und wie geht’s mir in Zukunft, wenn das immer noch online ist? Und will ich, dass jemand Drittes damit etwas macht, von dem ich nichts habe, aber jemand anderer einen Haufen Geld damit verdient?
Es geht auch um Partizipation im Freundeskreis und dem sozialen Geschehen. Wie können Jugendliche soziale Netzwerke konstruktiv nutzen?
Digitale Achtsamkeit bedeutet auch: Habe den Mut, dich der Funktionsweise deiner digitalen Geräte zu versichern. Jugendliche blicken selten hinter die sleeken und durchdesignten Oberflächen der Geräte und verstehen kaum noch, wie sie überhaupt funktionieren.
Die Jugendlichen sollten wissen, dass die Logfiles sämtlicher besuchter Seiten auf dem Smartphone gespeichert sind. Außerdem speichert das WLAN das Surfverhalten, was noch viel schwerer zu löschen ist. Gar nicht mehr zu löschen ist es auf dem Server des Internet Service Providers.
Saferinternet zeigt hier im Detail, wie man Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook, Instagram & Co einstellt. Welche persönlichen Daten sollten Schüler/innen keinesfalls ins Netz stellen?
Ich empfehle: Fülle nicht alles aus, was die Plattform von dir will und zeige nicht alles, was du zeigen könntest. Nur weil es auf Facebook die Möglichkeit gibt, muss ich Alter, Geschlecht, Interessen, Wohnort oder Schule nicht preisgeben.
„Fülle nicht alles aus, was die Plattform von dir will. Zeige nicht alles, was du zeigen könntest.“
Was ich noch für wichtig halte: Push und Pull-Nachrichten abzuschalten, damit das Telefon nicht permanent blinkt und Whatsapp-Nachrichten permanent auffordern, etwas von mir herzugeben. Die Technik auf Smartphones ist so konzipiert, dass sie mit Erregungszuständen und Anreizen spielt, um dauernd etwas von einem zu entlocken. Man muss sich fragen, wie wichtig ist es mir, dass ich in jeder Diskussion meinen Senf dazugebe.
Welche Rolle sollen Lehrer/innen in diesem Bildungsprozess einnehmen?
Für Lehrkräfte kann es interessant sein, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Dabei müssen sie nicht den Allwissenden geben, sondern mit gesundem Menschenverstand nachfragen. Eine goldene Regel: Was heißt es für dich, wenn jemand anderer über dich schreibt, was du gerade schreiben wolltest.
Bei Pädagoginnen und Pädagogen ist das Interesse aber relativ schnell ermattend, sie fühlen sich erschlagen und ohnmächtig. Doch sie sollen die Kinder und Jugendlichen auch nur begleiten und auf Beeinflussungsversuche oder versteckte Werbung hinweisen. Wichtig ist, mit Aufklärung und Information die Eigenkompetenz der Jugend zu unterstützen. Die Schüler/innen sollen selbst entscheiden lernen, was sie im Internet machen. Der moralische Zeigefinger nützt jedenfalls nichts, um mit ihnen die Vor- und Nachteile dieser Welt zu erforschen.
Ein anderer Weg kann sein, Jugendliche oder Geschwister zu schulen, die ihr Wissen den Gleichaltrigen oder auch den Eltern weitergeben.
Wie erklären Lehrende ihren Schüler/innen, dass im Internet nichts gratis ist, sondern persönliche Daten kostet? Wie werden Daten zu Geld gemacht?
Man könnte konkrete Beispiele nennen: Zum Beispiel hat ein Mädchen aus der Steiermark ihr Facebook-Profilfoto auf einem Strickpullover entdeckt. Ihr Urheberrecht wurde verletzt, weil weder jemand gefragt hat, ob ihr Foto abgebildet werden darf, noch wurde sie dafür bezahlt. Oder: Fotos von gestylten Mädchen tauchen ungefragt auf Bannern von Porno-Webseiten auf. Und: Augmented-Reality-Games wie Pokémon Go locken Spieler/innen an Orte, wo Geschäfte „rein zufällig“ einen Kaufimpuls auslösen sollen.
Früher schickten Unternehmen für Produktentwicklungen Studierende zu Straßenumfragen. Mittlerweile bestellen sie bei Google und Facebook Datensätze einer spezifischen Zielgruppe, gefiltert nach Geschlecht, Alter oder sozialer Schicht. Aus den Millionen Datensätzen werden dann Produkte entwickelt, auf die junge Menschen stehen.
Das Beispiel TikTok veranschaulicht die Datensammelwut mancher Apps.
Die Liste der Daten ist lang. TikTok sammelt automatisch Nutzername, Email-Adresse, Telefonnummer, Fotos, Nutzungszeiten, Sprachauswahl, Netzanbieter, Gerätenummer, Standort, Zeitzone, Mobilfunkmasten, WLAN, SSID, Bildschirmauflösung, Werbe-ID, Zahlungs-ID, Geschlecht, Alter, Umfrage-Auswertungen, Challenges und Wettbewerbe, Nutzerstatistiken, das Surfverhalten auf anderen Seiten mittels Cookies und Social-Media-Querverweise. Außerdem: Die Daten gehen auch an Drittanbieter.
Ihre Beobachtung: Wie geschärft ist das Bewusstsein für solches Datensammeln in Schulklassen? Wollen manche auch was dagegen unternehmen?
Nur wenige Jugendliche sagen, dass ihnen ihre Daten egal sind. Die meisten horchen gespannt zu und fragen sich, ob sie das wollen oder nicht. Die Mädchen sind vorsichtiger als die Burschen.
In der Praxis aber haben Schüler/innen – gerade in der Covid-Zeit – am meisten Kontakt mit ihren engsten Freunden. Sie chatten in größeren Whatsapp-Gruppen in Wort und Bild über die Themen, die sie interessieren und machen Termine aus. Bei anderen Dingen sind sie schon vorsichtiger.
Das Internet vergisst bekanntlich nicht. Wie lösche ich unerwünschte Datenspuren?
Man kann bei Plattformen das Löschen von Inhalten beantragen. Das Beispiel Myspace hat eben gezeigt, dass es wochenlang dauern kann, bis ein altes Foto endlich vom Server gelöscht wird. Schneller sollte das Löschen über einen „Trusted Flagger“ funktionieren. Das sind bei der Plattform gelistete Organisationen wie Rat auf Draht oder mimikama.at. Wenn diese bei Instagram oder Facebook Inhalte melden, die die Individualität oder Intimität der Jugendlichen einschränken, verschwinden diese auch schneller – zumindest meistens.
„Das Smartphone ist unsere verlängerte Identität – auf diese müssen wir aufpassen.“
Wenn ich wissen will, ob mein Email-Account gehackt wurde und welche Daten veröffentlicht wurden, empfehle ich HaveIbeenpwned.com. Die eigene Kompetenz in Sachen Privatsphäre kann ich auf Saferinternet.at ausprobieren. Dort haben wir Quizzes zum Umgang mit Snapchat, TikTok und Google.
Wie geht man sicher mit Passwörtern für mehr Privatsphäre im Internet um?
Das Betriebssystem des iPhones bietet die Option, sich vom Smartphone ein starkes Passwort vorschlagen zu lassen. Dieses kann im Passwort-Speicher am Handy gesichert werden. Der Standard für starke Passwörter: sechs bis acht Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen-Kombis.
Noch immer verwenden Schüler/innen naheliegende Passwörter wie Lieblingsfilme oder Haustiere. Auch Erwachsene sind keine guten Vorbilder, denn die drei meist verwendeten Passwörter im deutschsprachigen Raum heißen 123456, Hallo123 oder Passwort.
Die vielen verschiedenen Passwörter sollte man nicht am Computer, sondern extern auf einem oder besser zwei USB-Sticks speichern. Das Smartphone ist unsere verlängerte Identität – auf diese müssen wir aufpassen.
Mehr zum Thema Medienkompetenz:
Fobizz: Online-Medienbildung für Lehrkräfte
Rat auf Draht: Sexualität in digitalen Medien
Fachstelle Enter: Wie Lehrende Computerspiele verstehen lernen
Wo Gamer/innen ihr Hobby studieren können
Was lernt man eigentlich in der Medien HAK Graz?
Saferinternet: Barbara Buchegger über Online-Sexismus
Interview mit Mimikama-Faktenchecker Andre Wolf
Medienprojekte beim Media Literacy Award
WissenPlusVideo: #blacklivesmatter im Unterricht
Digital-Expertin Ingrid Brodnig über Verschwörungsmythen im Unterricht
WissenPlusVideo: Die Tricks der Fake News-Macher durchschauen