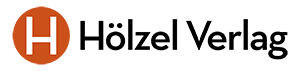Schwerpunkt: Wandel
„Tradition und Fortschritt müssen immer neu austariert werden“
Andreas Sator hat in seinem Buch den beschleunigten Wandel in der globalen Wirtschaft kurz angehalten und sich selbst ein paar unangenehme Fragen zu Nachhaltigkeit, Klimakrise und „Made in Bangladesh“ gestellt. Die Antworten fallen erstaunlich optimistisch aus.
Das Gespräch führte Stefan Schlögl - 22. Jänner 2020
Mit einem Papp-Kaffeebecher in der Hand an einer „Fridays for Future“-Demo teilnehmen: Darf man das noch?
Auf alle Fälle. Weil man für ein wichtiges gesellschaftliches und politisches Thema eintritt. Und dieses Anliegen hat eindeutig mehr Gewicht als die Frage, ob man nun aus einem Pappbecher trinkt oder mit einem Auto zur Demo anreist.

„Für ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen einzutreten hat eindeutig mehr Gewicht als die Frage, ob man nun aus einem Pappbecher trinkt oder mit einem Auto zur Demo anreist.“ Foto: Matthias Cremer
Eine der Grundthesen Ihres Buches lautet, dass 2018 das beste Jahr in der Geschichte der Menschheit war. Wenn ich einen kurzen Blick auf die einschlägigen News-Portale, auch die Ihres Arbeitgebers – DER STANDARD – werfe, erscheint das eher fraglich.
Natürlich geht es mir wie jedem, der gerne und viel Nachrichten liest: Es entsteht ein tendenziell pessimistisches Weltbild. Wenn man sich aber die Zahlen und Indikatoren ansieht, hat sich die Welt insgesamt positiv entwickelt.
„Wenn man sich die Zahlen und Indikatoren ansieht, hat sich die Welt insgesamt positiv entwickelt.“
Als ich 1990 zur Welt kam, lebten knapp 1,9 Milliarden Menschen in extremer Armut. Heute sind es knapp unter 600 Millionen, und das, obwohl die Weltbevölkerung stark gewachsen ist.
Gleichzeitig gab es noch nie so viele Menschen, die lesen und schreiben können. Diese Entwicklung passiert vor allem im globalen Süden – von dem man aber kaum etwas mitbekommt, wenn man eine österreichische Nachrichtenseite anklickt.
Was sind aus Ihrer Sicht die prägendsten wirtschaftlichen Veränderungen der vergangenen fünfzig Jahre?
Das lässt sich auf eine zuspitzen: die Globalisierung, weil sie nicht nur eine gewaltige wirtschaftliche, sondern auch eine enorme gesellschaftliche Veränderung nach sich gezogen hat. Wo wir jetzt politisch, ökonomisch und materiell stehen, ist Folge dieses Prozesses.
Gleichzeitig jedoch hat die Globalisierung viele ökologische Probleme, allen voran die Klimakrise, angefacht. All diese Veränderungen werfen unzählige komplizierte Fragen auf, die sich nicht immer rasch beantworten lassen.
Eine Antwort, zumindest in westlichen Gesellschaften, lautet: Nachhaltigkeit. Kein Politiker, kein Konzern kommt ohne dieses Zauberwort aus. Ist das nicht oft bloß eine Masche, um als ökologisch chic zu gelten?
Ja, absolut. Auch ich bin mittlerweile zuerst einmal skeptisch, wenn ich das Wort „nachhaltig“ höre. Für mich ist die teils inflationäre Verwendung dieses Begriffs aber auch ein Zeichen, dass Politik und Unternehmen in einer Übergangsphase stecken. Weil sie sehen, dass sich die Gesellschaft verändert hat und sie sich auch selbst verändern müssen.
Vor allem die Politik greift in Zeiten wie diesen gern zu Buzz-Wörtern wie „Nachhaltigkeit“. Damit kann sie sich vielleicht noch über die nächste Wahlentscheidung retten und etwas Zeit gewinnen. Aber angesichts des Klimawandels müssen irgendwann auch Taten folgen. Dann reichen Überschriften nicht mehr aus.
„Angesichts des Klimawandels müssen irgendwann auch Taten folgen.“
Dass ich mich und mein Konsumverhalten ändern sollte, habe ich mittlerweile hinlänglich mitbekommen. Sünder ist man schneller, als man glaubt. Soll ich in Zukunft in Sack und Asche gehen? Mit Schuldzuweisungen sind manche ziemlich schnell.
Und viele Aktivistinnen und Aktivisten verkennen auch ein wenig die schwierige Situation, in der viele Menschen leben. Alles, so das Dogma, muss sofort auf den Kopf gestellt werden, sonst geht die Welt unter. Doch kaum einer stellt eine positive Vision in Aussicht, wie ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel gelingen kann.
Was wäre so ein Positiv-Verstärker?
Heute gibt es technische Möglichkeiten, die vor zehn Jahren noch Utopie waren. Nehmen wir die Stromerzeugung durch Wind- und Solarkraft. Hier sind die Kosten auf einen Bruchteil gesunken.
Gleichzeitig werden die Anlagen immer besser. Vor zwanzig Jahren noch warst du im Dorf mit einem Solarpaneel am Dach ein schrulliger Öko. Heute ist das nichts Außergewöhnliches.
„Es dauert, bis sich soziale Normen innerhalb einer Gesellschaft ändern.“
Länger dauert es, bis sich auch die sozialen Normen innerhalb einer Gesellschaft ändern. Niemand in Österreich wird etwa seinen Hausmüll einfach auf die Straße kippen. Darüber besteht ein unausgesprochener Konsens. Beim Thema Klimawandel ist das ungleich komplexer, weil er einen individuell nicht gleich unmittelbar betrifft.
Ein Hemd, in das „Made in Bangladesh“ eingenäht ist, betrifft mich persönlich schon eher. Da tauchen in mir Bilder von Sweat-Shops und maroden Textilfabriken auf. Sie jedoch behaupten: „Made in Bangladesh“ ist gar nicht so böse. Warum?
Weil gerade in ärmeren Ländern eine einfache Industrieproduktion, in diesem Fall die Textilindustrie, helfen kann, die Lebensbedingungen zu verbessern. Anfangs nur auf bescheidenem Niveau, wie etwa auch in Österreich, als vor gut 200 Jahren die erste Textilfabrik im Süden Wiens entstand.
Mit der Zeit wurde die Wirtschaft produktiver und das Land reicher. Der Vorteil damals wie heute ist, dass man in der Fertigung keine großartige Ausbildung braucht. Speziell im sehr patriarchalen Bangladesh kommt hinzu, dass Millionen von Frauen nun ihr eigenes Geld verdienen – eine kleine gesellschaftliche Revolution.
Das alles soll jetzt nicht die teils schrecklichen Arbeitsbedingungen beschönigen. Es ist noch lange nicht ideal, aber eindeutig besser.
Warum nicht entsprechende Gesetze erlassen? Nur wer soziale und ökologische Standards einhält, darf in Österreich verkaufen.
Solche Ansätze gibt es bereits in Finnland oder Frankreich. Dort können Konzerne nach nationalem Recht haftbar gemacht werden. Technisch und vor allem ethisch ist das jedoch nicht so einfach: Gerade wir Europäer mit unserer kolonialen Vergangenheit sollten nicht den Eindruck erwecken, als würden wir anderen Ländern diktieren, an welche Gesetze man sich dort zu halten hat.
Bangladesh etwa hat trotz des Aufschwungs nur eine Wirtschaftsleistung, die der Österreichs vor 150 Jahren entspricht. Man stelle sich vor, damals wäre eine andere Nation gekommen und hätte gesagt: Liebe armen Österreicher, ab sofort macht ihr eure Textilien nach unseren Vorschriften und entsprechend unseren edlen Wertvorstellungen. Undenkbar! Dennoch halte ich strengere Regeln prinzipiell für sinnvoll, man muss dabei aber mit Umsicht vorgehen.
In Ihrem Buch gehen Sie dem Aufstieg Österreichs zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt auf den Grund. Woran lag’s? Weil wir immer so fleißig waren?
Das ist ein großer Mythos. Und daraus entsteht dann diese Haltung: Ihr Italiener, Rumänen, Afrikaner müsst euch einfach mehr anstrengen, und dann habt ihr es genau so gut wie wir. Nur bestätigt das die Forschung, die es dazu gibt, nicht.
In einer weltweiten Studie wurden etwa Eltern gefragt: „Wie wichtig ist Ihnen Arbeit im Leben?“ In Ghana zum Beispiel gaben 90 Prozent an, dass ihnen das sehr wichtig sei. In Deutschland nur 40 Prozent, weil dort, wie bei uns, andere Dinge mittlerweile wichtiger sind.
„Die Menschen in ärmeren Ländern arbeiten wesentlich härter als wir. Fleiß ist kein Indikator für Wohlstand.“
Glück, Zufriedenheit, Freunde. Tatsächlich arbeiten die Menschen in ärmeren Ländern wesentlich härter als wir, weil es kaum Digitalisierung oder Automatisierung gibt. Fleiß ist einfach kein Indikator für Wohlstand.
Als ab 1767 die ersten industriellen Spinnmaschinen anliefen, wurden sie von aufgebrachten Arbeitern prompt zerstört. Doch die „Spinning Jenny“ war unbestreitbar einer der Auslöser der industriellen Revolution, brachte Europa Umbrüche, aber auch Wohlstand. Was sagt uns das über das Verhältnis von Menschen und Innovationen?
Natürlich steckt in jedem von uns das Bedürfnis, so wenig wie möglich zu verändern, und das, was ist, zu bewahren. Die Welt um einen herum so zu wissen, wie sie immer war, fühlt sich einfach gut an.
Das ist auch evolutionär begründet: In der Geschichte des Menschen ging es sehr, sehr lange nur darum, zu überleben. Und da war es natürlich wichtig, das unmittelbare Gebiet um einen herum im wahrsten Sinne des Wortes überblicken zu können und von Menschen umgeben zu sein, denen man vertraute.
Spätestens mit dem Austausch von Gütern war es damit vorbei. Aber warum betrieben die Menschen Handel? Weil die einen etwas hatten, was den anderen fehlte. Status und Macht hingen nicht mehr von erfolgreicher Abschottung, sondern von Innovationskraft ab. Seitdem muss das Verhältnis dieser beiden Kräfte, Tradition und Fortschritt, immer wieder austariert werden.
Sie haben für Ihr Buch über 230 Quellen herangezogen. Das hat Sie dennoch nicht davor geschützt, in einen veritablen Shitstorm zu geraten. Was war da los?
Ich habe während der Recherche am Buch einen kurzen Ausschnitt daraus, zwei Sätze, auf Twitter gepostet. Eine knappe, vielleicht auch etwas zugespitzte Antwort auf die Frage: Ist Österreich nur deshalb reich, weil andere Länder arm sind? Diese populäre These drängt sich angesichts der verheerenden europäischen Kolonialgeschichte natürlich auf.
Aber sie ist eigentlich sehr verkürzt bis falsch – und das belege ich im Buch auch ausführlich. Auf Twitter jedoch habe ich diese Frage mit einem einfachen „Nein“ beantwortet.
Ohne dass die Leser alle Hintergründe zu Ihrer Einschätzung kannten?
Plötzlich stand ich als einer da, der Sklaverei und Kolonialismus leugnet oder zumindest verharmlost. Als die Reaktionen immer zahlreicher und schärfer wurden, wollte ich gar nicht mehr reagieren, weil jede Antwort die Leute noch mehr angestachelt hätte.
Das war eine Erfahrung, die mich aufrichtig getroffen hat. Ohne mein unmittelbares soziales Umfeld, meine Freunde, die mich kennen, wäre ich nicht so schnell aus dem Tunnel herausgekommen.
Und wie ist das Ganze ausgegangen?
Ich erhalte noch immer Nachrichten, in denen ich beschimpft werde. Aber mittlerweile ist auch das Buch erschienen. Und somit ist jeder herzlich eingeladen, mich auf Grundlage all meiner Argumente zu kritisieren.
Hat angesichts dieser Empörungskultur eigentlich ein Unternehmen heute noch Chancen, innovativ zu sein? Schließlich folgt echter Fortschritt nicht immer der Mode.
Einerseits wird es natürlich schwieriger, weil versucht wird, mit den Erwartungen, die Menschen von einem Unternehmen haben, konform zu gehen. Ein Shitstorm kann ja rasch eine Marke beschädigen. Andererseits kann das auch ein Anreiz sein, sich bewusst hinauszulehnen. Es gibt ja nicht nur die Empörten, sondern auch jene, die die sich von Neuem begeistern lassen.
Und dann gibt es noch die „schweigende Mehrheit“, die sich nicht explizit äußern, aber das vielleicht ganz toll finden. Grundsätzlich jedoch gilt: Empörung ist nicht per se schlecht. Sie ist in bestimmten Fällen sogar ausdrücklich erwünscht.
Von der Gegenwart ein Sprung in die Zukunft: Wenn ich mich heute schlafen lege und in 30 Jahren wieder aufwache: Was wäre die größte Veränderung, die ich bemerke?
Wir werden nicht mehr über Pappbecher reden, weil sich Politik, Wirtschaft, wir Menschen zum Positiven hin verändert haben. Und wir werden in einer Welt leben, in der uns das schlechte Gewissen nicht mehr plagt. Zumindest nicht mehr so stark.
Zur Person
Andreas Sator, Jahrgang 1990, ist Wirtschaftsjournalist bei der Tageszeitung DER STANDARD. Sein Podcast „Erklär mir die Welt“ ist einer der populärsten des Landes. Sator ist auf einem Bauernhof im Mostviertel aufgewachsen, hat an der HAK in Steyr maturiert und ein Studium der Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuni Wien abgeschlossen.
Kürzlich ist sein Buch „Alles gut?!“ erschienen:
Andreas Sator: Alles gut?!
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 2019
208 S., 22 Euro

Mehr dazu
Philosoph Liessmann: „Bildung ist keine Medizin, die gegen Fehlleistungen immunisiert“
Essay: Wandel – Mittendrin statt nur dabei
Pädagoge John Hattie: „Fehler als Chance sehen“
Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 4.