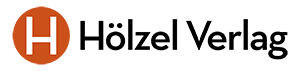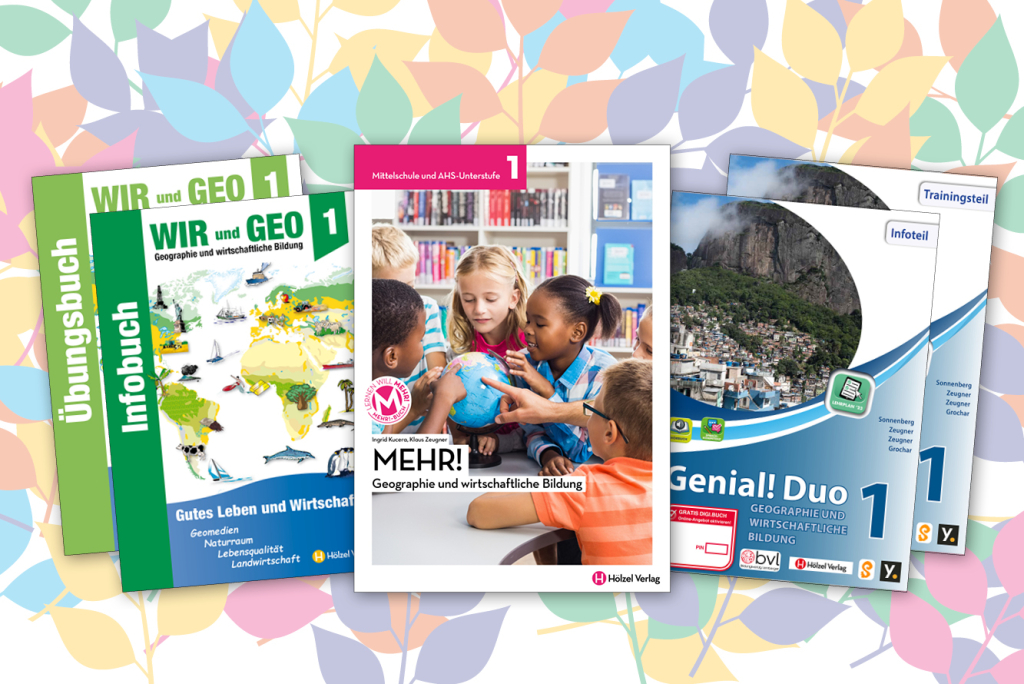
Geografie und Wirtschaftskunde
Geografie: Unsere AutorInnen im Interview
Der neue Lehrplan für Geografie und wirtschaftliche Bildung in der Sekundarstufe I hat sich gegenüber dem bisherigen Lehrplan in einigen Bereichen stark verändert. Das sagen unsere Schulprofis zu den neuen Büchern.
Dr. Lukas Birsak - 01. Februar 2023
Unsere AutorInnenteams berichten hier über ihre Arbeit an unseren neuen Büchern für Geografie und wirtschaftliche Bildung. Im Besonderen wird auf die Änderungen in den Bänden für die 1. Klasse eingegangen.
Der neue Lehrplan für Geografie und wirtschaftliche Bildung in der Sekundarstufe I hat sich gegenüber dem bisherigen Lehrplan in einigen Bereichen stark verändert. Eine Anpassung des Unterrichts an die neuen Schwerpunktsetzungen und deren Abfolge ist notwendig. Unsere aktuellen Bücher unterstützen gezielt bei dieser Umstellung. Im folgenden Interview haben wir je einen Autor bzw. Autorin unserer neuen Werke für den GW-Lehrplan befragt, wie sich die Änderungen in den Bänden für die 1. Klasse ausgewirkt haben.
Red.: Der neue Lehrplan wird von den GW-Lehrerinnen und -Lehrern einiges an Neuem verlangen. Wie stark hat sich das aus Ihrer Sicht in den neuen Büchern ausgewirkt?
MEHR! GW (Ingrid Kucera): Ich denke, dass sich die größte Veränderung in der ersten Klasse gleich zu Beginn zeigen wird. Für die Lehrpersonen bedeutet es eine Umstellung im „roten Faden“. Mit unserem Konzept versuchen wir alle Lehrerinnen und Lehrer, die GW unterrichten, ob geprüft oder ungeprüft, durch die Jahre zu führen und ihnen diesen „roten Faden“ in die Hand zu geben. Unser Buch ist damit eines der wenigen am Markt, das wirklich neu konzipiert wurde. Eine weitere Stärke liegt mit Sicherheit in der Themenauswahl und in den vielen Zusatzmaterialien, die wir differenziert ausgearbeitet haben. Wir haben uns sehr stark an den Interessen von 10/11-jährigen Kindern orientiert. Sie sollen mitdenken und verstehen, was da so alles passiert, natürlich altersentsprechend. Wir dürfen die Kinder nicht unterschätzen. Sie haben enorm viel zu sagen.
WIR und GEO (Marlies Pietsch): Die Umstellungen haben sich sehr stark ausgewirkt, da der wirtschaftliche Schwerpunkt nun verstärkt in der 1. Klasse beginnt. In diesem Alter fehlen noch wichtige Grundbegriffe und es ist schwierig, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Wirtschaft, Arbeit usw. sind Bereiche, die in der 3. und 4. Klasse für Schülerinnen und Schüler wesentlich „näher“ sind und dadurch auch interessanter. Grundsätzlich fehlt mir im Lehrplan doch eine klare Positionierung von „Inhalten und Wissen“, denn mit reflektieren, analysieren, bewerten und vergleichen alleine kommt es zu keiner Kompetenzerweiterung, wenn fachliche Kenntnisse fehlen. Daher haben wir versucht, in unserem Buch doch möglichst viele Inhalte (aber natürlich immer im Rahmen des Lehrplans) zu erarbeiten. Es wurden aufbauend auf den aktuellen Wissensstand für die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler differenzierte und individuelle Aufgabenstellungen formuliert. Mit anschaulichen Beispielen, Bildern und Experimenten wird der Kompetenzerwerb unterstützt.
Genial! Duo GW (Christian Sonnenberg): Aus meiner Sicht sind die Änderungen im neuen Lehrplan für Geografie und wirtschaftliche Bildung sehr gravierend, bedeuten sie doch nicht nur eine eindeutige Verschiebung hin zu mehr wirtschaftlichen Inhalten, sondern auch zu sozialpolitischen Fragestellungen. Wie weit diese Verschiebungen schon in der Unterstufe, also der 10-14jährigen, wirklich Sinn machen, sei an dieser Stelle kritisch angemerkt. Diese Änderungen durch den neuen Lehrplan haben daher natürlich auch die Inhalte und Aufgabenstellungen in den neuen Lehrwerken stark verändert (Kompetenzchecks, Kennzeichnung der Arbeitsaufgaben nach verschiedenen Niveaus usw.)
Red.: Gehen wir auf einige Neuerungen genauer ein. Medial viel diskutiert wurden z.B. die neuen Schwerpunkte „Finanzielle Bildung“ und „Entrepreneurship Education“, die den Anteil der wirtschaftlichen Bildung in dem Kombinationsfach verstärken. Wie wurden diese Themen konkret in Ihren 1. Bänden umgesetzt?
MEHR! GW: Wir gehen in „Mehr! GW“ wirklich altersgerecht an das Thema heran. Aus meiner Erfahrung als Lehrerin, aber auch als Mama, weiß ich, dass die Kinder für das Thema „Geld“ sehr zugänglich sind und zum Teil großes Interesse zeigen. Im Buch der ersten Klasse findet sich das Thema in Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Kinder und der Frage, wie viel Geld sie brauchen, um diese zu erfüllen oder was sie mit ihrem Taschengeld machen. Es finden sich schon erste Tipps für den Umgang mit Geld. Auch zehnjährige Kinder haben bereits ein „Sparschwein“ oder gehen einkaufen. Dass die billigen Produkte meist ganz unten im Regal zu finden sind oder dass Aktionen oftmals in ein Geschäft locken sollen, nehmen sie als Themen an, die sie in ihrem Leben auch betreffen.
WIR und GEO: Grundbegriffe zu Geld wurden definiert, Basisinformationen zu finanzieller Bildung wurden mit einer exemplarischen Auflistung und Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben eines „Musterhaushaltes“ gegeben. Auch der Bereich Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit Geld wurde exemplarisch erarbeitet. Gegebenheiten der Entrepreneurship Education kommen in unterschiedlichen Bereichen vor, werden aber noch nicht explizit thematisiert.
Genial! Duo GW: Der Lehrplantext „ Das Produzieren und Konsumieren im Wirtschaftskreislauf sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld (Einnahmen und Ausgaben) anhand von Fallbeispielen aus dem eigenen Umfeld analysieren“ wird in den Kapiteln „Wie und was kaufe ich ein?“ und „Was erzeugen wir noch selbst?“ abgedeckt. Auch durch die Darstellung der Taschengeldproblematik im Kapitel „Wie kann ich meine Wünsche erfüllen?“ wird das Thema behandelt. Der Wirtschaftskreislauf und insbesondere Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel Haushaltsbudget dargestellt. Die altersgerechte Aufbereitung dieser wirtschaftlichen Themen erfolgt dabei durch eine Fülle von Arbeitsaufgaben im Trainingsteil des Schulbuchs.
Red.: Neu ist auch der Start in der 1. Klasse mit der Erkundung des eigenen Umfelds der Schülerinnen und Schüler statt wie bisher mit einem Blick auf die Erde. Ist das ein Paradigmenwechsel vom bisherigen globalen Einstieg zum alten Prinzip „Vom Nahen zum Fernen“ oder der Versuch, im Fach den Menschen gegenüber dem Raum noch mehr Gewicht zu geben? Wie konnten Sie die anspruchsvollen Kompetenzformulierungen zu „eigene Wünsche und Bedürfnisse formulieren und reflektieren“ in Schulbüchern für 10- bis 11-Jährige umsetzen?
MEHR! GW: Dies kann aus meiner Sicht tatsächlich als Paradigmenwechsel verstanden werden und ruft zum Teil auch Unverständnis hervor. Die Kinder würden bereits über Lebensstile diskutieren, aber wissen eigentlich gar nicht, wo sie wirklich leben. Wir werfen aber auch weiterhin selbstverständlich einen Blick auf die Erde und lassen die Kinder von ihrem eigenen Lebensfeld ausgehend die Welt erkunden.
Wünsche und Bedürfnisse sind ja als Basis des Wirtschaftens an sich zu verstehen, insofern stellen sie auch einen wichtigen Einstieg in das Fach dar. Eine Herausforderung bleibt allerdings für die Lehrkraft bestehen, was beispielsweise den finanziellen Background der Kinder betrifft bzw. auch allein schon dadurch, dass von den Kindern gleich zu Beginn persönliche Informationen erwartet werden. Da kann es dann schon sein, dass manche Kinder eine Playstation nicht unbedingt als Luxusbedürfnis sehen, aber ein anderes Kind froh wäre, wenn es überhaupt ein Smartphone hätte.
WIR und GEO: Der Bereich Erkundung des eigenen Umfeldes wurde unter dem Blickwinkel des Raumes, ausgehend vom Wohnort, über Schulort, Heimatbezirk, Bundesland, Staat, Kontinent, Erde, aber auch über die Begriffe lokal, regional, global betrachtet. Die Lehrplanforderung „eigene Wünsche und Bedürfnisse formulieren und reflektieren“, wurde aufbauend auf einer Bedürfnispyramide erläutert, diskutiert, formuliert, verglichen und reflektiert. Es wurde sehr bewusst auf konkrete Arbeitsaufgaben aus dem eigenen Umfeld verzichtet, denn das ist unserer Meinung nach eine sehr persönliche Situation und die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler muss respektiert werden.
Genial! Duo GW: In dieser Schulbuchreihe sind wir schon bisher vom eigenen Umfeld der SchülerInnen ausgegangen, sodass sich auch jetzt folgender Kapitellauf für die Orientierung der SchülerInnen in ihrer Lebenswelt ergibt:
- Wo wohne ich Österreich
- Wo würde ich gerne leben (Stadt-Land Problematik)
- Was kenne ich schon von Europa?
- Was kenn ich schon von der Welt?
- Wie kann ich unsere Erde beschreiben?
- Wie orientiere ich mich auf der Erde?
Die genannten anspruchsvollen Kompetenzformulierungen wurden durch neue Kapitel im Buch, die helfen sollen, diese Lehrplanformulierungen in die Praxis umzusetzen, abgedeckt.
Red.: Es fehlt im neuen Lehrplan der explizite Inhalt, in einem Kapitel mit Globus, Karte, Atlas und Bildern zu arbeiten (bisher „Ein Blick auf die Erde“). Dafür zieht sich die Aufforderung, mit „Geomedien“ Informationen zu finden, durch viele Kompetenzbereiche. Bedeutet das in Ihren Büchern mehr oder weniger Kartenarbeit?
MEHR! GW: Für das Buch bedeutet das, dass viele Aufgabenstellungen eingearbeitet wurden, die mit unterschiedlichen Geomedien bearbeitet werden können. Im Lehrerhandexemplar wird es zahlreiche Hinweise für die Arbeit mit Geomedien geben. Da doch die meisten SchülerInnen im Rahmen der Geräteinitiative Laptops oder Tablets erhalten haben und ja auch im Lehrplan die „Informatische Bildung“ als übergreifendes Thema angeführt ist, wird es hier ein verstärktes Angebot an die LehrerInnen geben. Die Einarbeitung ins gedruckte Buch ist aufgrund der Aktualisierungsnotwendigkeit jedoch oftmals nicht sinnvoll.
WIR und GEO: Am Beginn des Buches werden Begriffe, Methoden und Informationen zu Geomedien in geblockten Ausführungen bearbeitet. Dies wurde aus der Überlegung heraus so konzipiert, dass Arbeitstechniken und Begriffe bekannt sein müssen, damit dann mit Fallbeispielen gearbeitet werden kann. Das Buch bietet in den unterschiedlichen Bereichen viele Aufgabenstellungen und somit auch ausreichend Möglichkeiten zur Kartenarbeit.
Genial! Duo GW: In der Reihe Genial! Duo wird auch weiterhin viel Wert auf die Arbeit mit Karten gelegt, wobei viele Arbeitsaufgaben die Verortung geografischer Inhalte nicht nur mit Hilfe des Atlas, sondern auch mit Hilfe der modernen digitalen Medien (Smartphones, Tablets…) fördern und fordern.
Red: „Die kontinuierliche regionale Zuordnung der Fallbeispiele unterstützt den Aufbau eines topografischen Grundgerüstes“ steht im neuen Lehrplan. Wie wichtig ist Topografielernen für Sie in Zeiten von Google Maps und Co.?
MEHR! GW: Ich sehe das Topographie-Lernen im Vergleich zu meiner eigenen Schulzeit etwas „entspannter“ und vertrete die Meinung, dass man heute nicht mehr alle Hauptstädte der Welt „einfach so“, also ohne Zusammenhang, aufsagen muss. Dennoch erschreckt es mich immer wieder, wie wenig Vorstellungsvermögen von der Welt vorhanden ist. Also ja, Topographie-Lernen bleibt ein wichtiges Thema, weil es einfach wichtig ist, dass die SchülerInnen die Themen auch regional zuordnen können.
WIR und GEO: Der sichere Umgang mit der Topographie ist auch in Zeiten von Google Maps eine wichtige Säule des Faches. Globale wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen ist nur möglich, wenn ein topographisches Grundgerüst vorhanden ist. Zu allen Fallbeispielen und das sind viele gibt es Aufgaben zur Verortung und manchmal auch zur Beschreibung der Lage, des Raumes, etc.
Genial! Duo GW: Auch in Zeiten von Google Maps und Co. ist der Aufbau eines topographischen Grundgerüsts bzw. einer gesicherten räumlichen Vorstellung dieser Welt unerlässlich. Dieses Grundgerüst ermöglicht erst, im Alltags- und Berufsleben rasch richtige Einordnungen, Aussagen und Entscheidungen zu treffen. Erst in einem zweiten Schritt sind Google Maps und Co. dann zum Verifizieren dieser Inhalte gut geeignet. (Man stelle sich ein Gespräch vor, bei dem man vor einer Antwort immer zuerst „googlen“ muss!)
Red.: Im neuen Lehrplan fehlt das Erfassen der „Regelhaftigkeit in der Anordnung klimatischer Erscheinungen auf der Erde“ („Klimazonen“). Dafür soll viel über den Klimawandel gelernt werden. Geht das überhaupt ohne Grundwissen über das Klima? Wie sind Sie mit dem Thema „Klima“ in Ihren Büchern umgegangen?
MEHR! GW: Das war für mich in der Entstehung des Lehrplans eine sehr spannende Diskussion, weil ja vorgesehen war, dass die Klimazonen in der bekannten Form überhaupt nicht mehr behandelt werden sollen, wobei das Thema bisher ja auch nie in seiner absoluten Vielfältigkeit und seinen regionalen Besonderheiten dargestellt wurde. Ich bin jedoch der Meinung, dass die SchülerInnen eine ungefähre Vorstellung brauchen, um dann auch die komplizierte und komplexe Thematik des Klimawandels einordnen zu können. Wie kann ich verstehen, dass sich etwas wandelt, wenn ich gar nicht weiß, was sich wandelt? Wir haben daher die Klimazonen ganz traditionell ins Buch mit aufgenommen, weil sie eine wichtige Basis für das „Leben und Wirtschaften weltweit“ darstellen.
WIR und GEO: Es ist kaum möglich, das Leben und Wirtschaften in einer Region zu verstehen, wenn man nicht weiß, wie die klimatischen und naturräumlichen Bedingungen dort sind. Wir haben es in der Form gelöst, dass mit Schlüsselbegriffen die klimatischen Gegebenheiten der Fallbeispiele, die aus den unterschiedlichen klimatischen Gebieten genommen wurden, beschrieben werden. Schülerinnen und Schüler ordnen in einer Arbeitskarte (angelehnt an die Klimazonenkarte) die Fallbeispiele aufgrund der Schlüsselbegriffe zu. Wetter und Klima wurden grundlegend erklärt, um dann den Klimawandel erarbeiten zu können. Dem Klimawandel wurde breiter Raum gegeben, sowohl auf regionaler Ebene als auch auf globaler Ebene. Durch viele Beispiele, wie Kinder die Auswirkungen des Klimawandels in unterschiedlichen Regionen der Erde erleben, soll den Schülerinnen und Schülern die Wichtigkeit dieser Thematik verdeutlicht werden.
Genial! Duo GW: In dieser Buchreihe wird auch weiterhin das Grundwissen über die klimatischen Verhältnisse auf dieser Erde vermittelt: Im Großkapitel „Verschiedenen Lebenswelten“ werden in den Unterkapiteln Klima und Wetter, die Klima- und Vegetationszonen der Erde und die daraus ableitbaren verschiedenen Lebenswelten der Menschen ausführlich dargestellt.
Red.: Die Arbeit in und von Unternehmen soll schon in der 1. Klasse thematisiert werden. Wie wirkt sich das in den ersten Bänden aus?
MEHR! GW: Unternehmen werden erstmalig in Zusammenhang mit dem einfachen Wirtschaftskreislauf dargestellt, allerdings anhand von Beispielen, zu denen die SchülerInnen auch einen persönlichen Zugang haben, wie beispielsweise der Supermarkt.
WIR und GEO: Unternehmen wurden in den unterschiedlichen Bereichen erwähnt, aber in ihrer Struktur und ihren Aufgaben per se nicht bearbeitet. Dieser Themenbereich ist ein sehr komplexer, es müssen Grundkennnisse gelegt werden, und daher werden wir in der 6. Schulstufe mit den grundlegenden Informationen und Zusammenhängen beginnen.
Genial! Duo GW: In dieser Reihe stellen wir in der 1. Klasse vor allem die Arbeit und die Produktion in Unternehmen aus dem primären Wirtschaftssektor vor: Es werden die biologische Nahrungsmittelproduktion (Biobauernbetrieb), die Milchproduktion (Bergbauernbetrieb/ Heumilchproduktion) oder die Gemüseproduktion im Marchfeld behandelt, ebenso wie die Fischerei. Eine einfache Darstellung einer unternehmerischen Tätigkeit erfolgt aber auch im Kapitel „Hilfe zur Selbsthilfe“, wo die Produktion von Stoffsouvenirs und deren Vermarktung in Äthiopien vorgestellt wird. Erst in der zweiten Klasse wird die Produktion im sekundären Wirtschaftssektor (Produktion in Industrie und Gewerbe) sehr ausführlich behandelt werden.
Red.: Im neuen Lehrplan ist die Behandlung städtischer Zentren in die 1. Klasse gewandert, die Ressourcen dagegen in die zweite. Ist das sinnvoll? Wie wirkt sich das in Ihren Büchern aus?
MEHR! GW: „Die Stadt“ als Thema, wie wir es bisher kannten, gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Wir thematisieren Zentren und Peripherien, wir unterscheiden dabei z.B. die Daseinsgrundfunktionen oder vergleichen die Mobilität zwischen Stadt und Land. Aber die Unterscheidung zwischen einer nordamerikanischen oder europäischen Stadt ist im Lehrplan in der Form nicht mehr zu finden. In der 4. Klasse wird die „Entwicklung, Bedeutung und Verteilung von Städten, Ballungsräumen und Peripherien“ in der globalisierten Welt wieder als Thema aufgenommen.
WIR und GEO: Wir haben Fallbeispiele von Städten aufgezeigt und Vergleiche angestellt. Unter Einbeziehung der digitalen Medien können Schülerinnen und Schüler weitere Informationen recherchieren. Ressourcen werden im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit erarbeitet.
Genial! Duo GW: In dieser Schulbuchreihe haben wir versucht, das Leben in Städten in den verschiedenen Klimazonen und den verschiedenen Lebenswelten auf dieser Erde darzustellen: Leben in einer Stadt in den Tropen am Beispiel Manaus, Leben in einer Stadt in Wüstennähe am Beispiel Kairo usw. Dadurch ist natürlich der bisherige Ansatz, die Stadtstrukturen und Stadtentwicklungen zu vergleichen, in den Hintergrund getreten und es sind die Lebensbedingungen und Lebensweisen in den Vordergrund gerückt. Die Ressourcen werden in der 1. Klasse in diesem Band im Kapitel „Nahrungsmittel und Klimawandel“ in einem ersten Schritt angesprochen (Treibhauseffekt, alternative Energiequellen…), eine ausführliche Gegenüberstellung zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen erfolgt dann in Band 2. Über die Sinnhaftigkeit dieser neuen Aufteilung lässt sich streiten, Tatsache ist, dass der neue Lehrplan eine andere Gewichtung und Anordnung als bisher fordert.
Red.: Die Abhängigkeit menschlichen Handelns von natürlichen Voraussetzungen scheint im neuen Lehrplan noch weniger thematisiert zu werden als bisher: Bisher gab es Begriffe wie „regionale Voraussetzungen“ oder „Naturbedingungen“, im neuen Lehrplan scheinen nur mehr „Naturereignisse“ einen Einfluss auf menschliches Handeln zu haben. Haben Sie das Gefühl, dass Themen der physischen Geografie zu wenig Raum gegeben wird?
MEHR! GW: Die „traditionelle physische Geografie“ hat sicher an Bedeutung verloren. Es gibt kein Kapitel zu den Großlandschaften in Österreich, keine klassischen Klimazonen. Wenn man aber den Fokus verstärkt darauf legt, dass die physische Beschaffenheit der Erde, Klima und Wetter als Basis für das Leben und Wirtschaften gesehen werden, so finden wir die physische Geografie in sehr vielen Kompetenzbereichen verankert: Die große Bedeutung des Wetters für die Landwirtschaft, Wohnen in unterschiedlichen Klimaten, Rohstoffvorkommen …
WIR und GEO: Themen der physischen Geografie kommen im neuen Lehrplan zu wenig vor. Inhalte der physischen Geografie sind für wirtschaftliche und politische Entscheidungen unumgänglich, daher wäre es wünschenswert gewesen, diesen Bereichen für alle Umweltthemen, Ressourcenthemen, „Lebensthemen“, Wirtschaftsthemen (Standort, Verkehr …) breiteren Raum zu geben. Als Anmerkung am Rande: Schülerinnen und Schüler sind für die Inhalte aus der physischen Geografie und für die Kartenarbeit leicht zu begeistern.
Genial! Duo GW: Es ist eine Tatsache, dass die physische Geografie, im Gegensatz zur Geografie in den angelsächsischen Ländern, im deutschsprachigen Raum immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Das liegt wohl auch daran, dass es in Ländern wie GB und USA ein eigenes Fach „Wirtschaft“ (= Economics) gibt, und daher dort „traditionelle“ geografische Inhalte im Fach Geografie bleiben (how landscapes, rivers, and glaciers are formed…). Tatsache ist aber auch, dass die Hereinnahme von wirtschaftlichen Inhalten bei gleichzeitiger Reduktion von „traditionellen“ geografischen Inhalten die Stellung und Bedeutung des Faches in Österreich im Fächerkanon der Schule gestärkt hat.