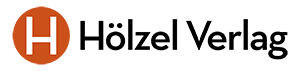Schwerpunkt: Wandel
Wandel: Mittendrin statt nur dabei
Wo fängt er an? Wann hört er auf? Und warum bloß trifft er immer mich? Ein Einblick in das Tagesgeschäft unserer Spezies: den Wandel.
Ein Essay von Stefan Schlögl - 18. Dezember 2019
Abbrechen, aufgeben, neu starten, umwandeln, umdenken, etwas nicht oder doch zu einem Ende bringen. Anlässe gibt es genug, sein Leben zu ändern. Leider hat der Mensch die Tendenz, Situationen eher auszuhalten, als aufzulösen.
Schließlich droht vor dem erhofften Gewinn mitunter ein schmerzhafter Verlust. Also lieber zuwarten. Sei es, wenn es um die Beziehung geht oder den Job. Klingt bekannt und ziemlich verzwickt. Die Lösung: Einfach mal eine Münze werfen!
„Anlässe gibt es genug, sein Leben zu ändern. Leider hat der Mensch die Tendenz, Situationen eher auszuhalten, als aufzulösen.“
Das zumindest legt das Ergebnis einer Studie nahe, die der Ökonom Steven Levitt von der University of Chicago 2016 publiziert hat. Dazu ließ er Testpersonen, die sich gerade in einem ernsthaften Dilemma befanden, auf seiner Website eine virtuelle Münze werfen. Bei Zahl sollten sie alles so lassen, wie es war. Bei Kopf: Veränderung!
Zudem ließ der Wissenschafter abfragen, um welches Problem es sich handle. (Platz eins belegte übrigens die Frage, den Job zu kündigen, Platz zwei, eine Beziehung zu beenden.) Fortan wurde von insgesamt 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die virtuelle Münze geflippt, ein Jahr lang lief der Test.

Der Wandel gehört zum Menschsein dazu, von Anfang an. Grafik: Shutterstock.
Nach mehreren Monaten fragte der Forscher nach, ob und wie sich die Ja-oder-Nein-Nummer auf ihr Leben ausgewirkt habe. Ein Fazit: Unter denjenigen Personen, die sich bei ihren großen Fragen an das Ergebnis gehalten hatten, waren jene glücklicher, die sich verändert hatten; und jene unglücklicher, bei denen kraft des Münzwurfs alles beim Alten geblieben war.
Die höhere Erkenntnis: Zwar scheuen Menschen das Risiko großer Veränderungen – sie tun ihnen aber offensichtlich gut. Und es bedarf mitunter nur eines kleinen Auslösers – einer Münze! –, um den einen großen Wandel anzustoßen.
„Zwar scheuen Menschen das Risiko großer Veränderungen – sie tun ihnen aber offensichtlich gut.“
Fies bloß, dass die Aufforderung, sich zu ändern, auch einen selbst ereilen kann. Als besonders heftig beschleunigt gelten zurzeit gesellschaftlicher sowie medialer Wandel. Mit Argwohn oder Staunen werden die Kultur- und Wertewandel beäugt. Bedroht scheint der eigene Arbeitsplatz von der digitalen Transformation, die eigene Existenz gar vom Klimawandel. Kurzum: Die Bürde der Veränderung lastet schwer auf dem Menschen.
Dabei ist der Wandel hin zu etwas Anderem, etwas Neuem – Schlag nach bei Darwins Evolutionslehre – das Tagesgeschäft unserer Spezies. Die Menschheit hätte niemals so etwas wie Fortschritt in Gang setzen können, wenn nicht immer wieder neue Arbeits- und Handlungssysteme entwickelt worden wären, wenn Religion oder Familienstrukturen, Alltags- und Kulturtechniken nicht fortwährend redefiniert, ausverhandelt, hinterfragt, zerstört oder aufgebrochen worden wären.
Nicht zuletzt der eigene soziale Status wird im Gefolge gesellschaftlicher Umwälzungen laufend auf den Prüfstand gestellt. Dass heute etwa jeder freien Zugang zu Bildung genießt, galt vor 150 Jahren noch, in den großteils feudalistisch und autokratisch regierten Nationalstaaten Europas, als undenkbar.
Dass Revolutionen, das Aufbegehren von Bürgertum und Proletariat, neue politische Parteien (und ein Weltkrieg) diese Systeme hinwegfegten, wurde von den damals Mächtigen, dem Adel, dem Militär und einer privilegierten Beamtenschaft, als verheerende Zäsur empfunden – zu verhindern wäre dieser in ganz Europa einsetzende Epochenwandel dennoch nicht gewesen.
1918 fand dieser Umbruch statt. So steht es in den Büchern geschrieben. Menschen und Massenmedien lieben es, historische Veränderungen an einem exakten Zeitpunkt oder an einer Person, einem Erfinder, einem Wissenschafter, einem Politiker festzumachen. Das erweckt im Rückblick den Anschein von Struktur und Übersicht.
Tatsächlich ist aber das größte Problem mit dem vermaledeiten Wandel, dass er sich, wenn er einmal läuft, nicht einfach so verorten lässt. Wir wissen schlicht nicht, in welcher Phase der Veränderung wir und das Soziotop, das uns umgibt, gerade stehen.
Befinden wir uns am Anfang? Sind wir mittendrin? Und wann hört das endlich auf? Oder anders gesagt: Ist jetzt der Zeitpunkt, Schluss zu machen? Den Job hinzuwerfen? Noch einen Master dranzuhängen? Ein weiteres Kind zu bekommen?
„Befinden wir uns am Anfang? Sind wir mittendrin? Und wann hört das endlich auf?“
Oder kommen von außen neue Transformations-Trigger hinzu (ein anderer Chef, ein neuer Liebhaber, eine Erbschaft), die den eigenen Veränderungsprozess wieder in neue Bahnen lenken? Zuwarten oder durchziehen? Das ist hier die Frage.
Tröstlich allein: Auch Wissenschaftern fällt es trotz ihres riesigen statistischen Werkzeugkastens mitunter schwer, die individuellen oder sozialen Umschichtungen abseits von Zahlen zu fassen und sie in Richtung exakter Zukunftsprognosen zu interpretieren. So steht etwa außer Zweifel, dass in westlichen Wohlstandsgesellschaften gerade der sogenannte demografische Wandel läuft, also immer mehr Menschen älter werden und immer weniger Junge nachrücken.
Was das jedoch langfristig bedeutet und wie diesem Phänomen zu begegnen ist, verliert sich in tagespolitischem Kleinklein und verschwindet hinter sloganhaften Reizwörtern wie Pflege, soziale Transferleistungen, Altersarmut oder Migration.
Es ist also – wie eben auch bei der Klima-Debatte – verdammt schwer, anhand winziger Messpunkte so etwas wie die große Linie eines gesellschaftlichen Wandels zu identifizieren. Oder jenen Moment, in dem eine lange unterhalb der Wahrnehmung vor sich hin glosende Veränderung plötzlich zu einer Eruption führt. Anfang 1989 ahnte keiner der DDR-Granden, dass ihr Arbeiter- und Bauernstaat vom Volk hinweggefegt werden würde.
Oder die Anschläge vom September 2001: Zwar wussten die Geheimdienste der USA, der größten Militärmacht der Welt, von einem Islamisten, der sich in den Höhlen Afghanistans verschanzte; die Transformation Osama bin Ladens hin zum Super-Terroristen, der die USA mit den Anschlägen aufs World Trade Center erschüttern sollte, vermochten sie indes nicht vorherzusagen.
Und der britische Premier David Cameron hielt – samt Meinungsforschern und Kommentatoren – die Abstimmung über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union wohl für reine Formsache. Bis Europa am 24. Juni 2016 aufwachte – und der Brexit vor der Tür stand.
Aber es war nicht dieser „Abstimmungsunfall“, der bei vielen zu einer Neujustierung ihres Verhältnisses zur EU führte, sondern die anschließende Debatte darüber, wofür denn dieses supranationale Gebilde eigentlich steht.
Plötzlich wurde wieder darüber diskutiert, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein, in einer Union zu leben, die über Jahre hinweg nur als Subventionsgeber, mutmaßliche Beamten-Kleptokratie und Hort diverser Gurkenkrümmungsdebatten aufgefallen war. Nicht der Anlass, sondern das Nachdenken darüber und das Abwägen der Meinungen führte zu einer Veränderung von Haltungen und Werten.
Und ja: Wandel ist mühsam. Für jeden, vor allem für das menschliche Gehirn. Jenes Organ, in dem all die externen Einflussfaktoren unter Berücksichtigung unseres Vorwissens, unseres Beziehungsnetzwerks und unserer Identität zu einer intrinsischen Motivation verarbeitet werden, die dann tatsächlich dazu führt, unser Verhalten und unsere Einstellungen zu verändern. Das ist ein aufwändiger Prozess.
Blöd nur, dass so ein Gehirn Energieaufwand meidet, wo es nur geht. Also trachtet es danach, wertvolle Ressourcen mithilfe von Automatismen, Routinen und des Abrufens bereits gemachter Erfahrungen zu schonen.
Doch die müssen angesichts von außen einstürmender Änderungsanträge neu bewertet oder umstrukturiert werden. Und nicht nur das: Gleichzeitig sollte diese Abkehr von alten Gewohnheiten mit unserem Bedürfnis, autonom und selbstbestimmt zu handeln, und unserer Rolle innerhalb unseres sozialen Netzwerks abgestimmt werden.
„Veränderung, das ist ein hochambivalentes Phänomen. Wir suchen sie zu vermeiden, scheuen ein mögliches Opfer.“
Nur wenn diese drei Faktoren miteinander in Einklang sind, wird aus dem mechanischen Einhalten von Regeln echtes Engagement, wird eine Veränderung als Bereicherung des eigenen Lebens empfunden. Sagt die Psychologie.
Das alles wird jedoch erheblich verkompliziert, weil man – siehe oben – schlichtweg nicht wissen kann, was die Zukunft kurz- oder langfristig von dem ganzen intrinsischen Aufwand hält. Da kann man etwa die angestrebte „Typveränderung“ beim Friseur persönlich noch so toll finden, wenn daheim dann die Kinder die Augen verdrehen.
Oder Zeit und Energie in eine Partnerschaft investieren, die, statt Kraft zu spenden, diese entzieht. Veränderung, das ist ein hochambivalentes Phänomen. Wir suchen sie zu vermeiden, scheuen ein mögliches Opfer.
So wie auch Institutionen und Systeme danach trachten, im Schatten beschleunigter Transformation ihren Bedeutungsverlust zu minimieren. Seien es die Kirchen oder das Patriarchat, die Sozialdemokratie oder die Banken. Und ja, auch das System Schule kann sich den Zeitläufen nicht entziehen.
Manche Veränderungen lassen sich gar nicht steuern. Etwa eine Kündigung, der Tod eines lieben Menschen, eine Trennung. Ereignisse, die sich nicht so einfach mit gut gemeinten Ratschlägen und Instant-Weisheiten wegbügeln lassen.
Erst nach einer Phase der Trauer und der Wut können Sentenzen wie jene aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ mit Sinn aufgeladen werden: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
Tatsächlich geht vom Reiz des persönlichen Wandels, der Verheißung, das Alte hinter sich zu lassen und sich neu zu erfinden, eine enorme Faszination aus. „Ich muss etwas in meinem Leben verändern!“, ist nicht nur ein oft einfach so dahin gesagter Satz – er ist die Triebfeder für jede gute Story.
Schon in der Bibel wird ohne Unterlass gewandelt (vom Saulus zum Paulus, vom Gierhals zum Gönner und natürlich vom Heiden zum Christen), kein Comic-Superheld kommt ohne Identitätswechsel aus, keine Romantik-Komödie ohne die Erkenntnis des einst lotterhaften Filous, sich dann doch in einen treuen, liebevollen Lover zu wandeln.
Einschlägige Großromane („Der Mann ohne Eigenschaften“, „Anna Karenina“, „Die Buddenbrooks“ nur zum Beispiel) setzen ihr Personal unzähligen Veränderungsanliegen aus. Mal gespenstisch, wie in Franz Kafkas „Die Verwandlung“, in der der Romanheld sich als Ungeziefer wiederfindet, mal phantastisch grell und überhöht wie in „Alice im Wunderland“ sind die Metamorphosen.
„Schon in der Bibel wird ohne Unterlass gewandelt, kein Comic-Superheld kommt ohne Identitätswechsel aus.“
Flankiert wird das offensichtliche Bedürfnis, den eigenen Reboot zu inspirieren, von allerlei Unterweisungen zur Sinn- und Selbstsuche sowie vom in den vergangenen Jahren boomenden Genre der Ratgeber- und Reiseliteratur.
Dicht an dicht stehen in den Regalen die Berichte von Protagonisten in Funktionswäsche, die per pedes oder mit einem Vehikel und unter instagramtauglichem Verzicht die Welt erkunden. (Das ist übrigens kein Widerspruch, wie ein Blick auf Ihr Smartphone-Display beweist.)
Von der Almhütte bis zum fernen Tibet reichen die Verheißungen, die „angegangen“ werden, begleitet von einem mantrahaften „Ich bin dann mal weg“ im Ohr. Titel jenes Buches, das vor 13 Jahren die neue Einfach-raus-Bewegung begründet hat.
Staunend sahen wir damals dem Comedian Hape Kerkeling dabei zu, wie er sich auf dem Jakobsweg vom schrillen Medien-Phänomen zum einfachen, aber glücklichen Sinnsucher wandelte
Eine Erzählung, die nicht zuletzt im Begriff „Wandel“ selbst angelegt ist, steht doch das althochdeutsche Verb „wanton“ für „wiederholt wenden“ und beschreibt dabei nicht nur die Bewegung, sondern auch ihr Resultat. Gleichzeitig ist dieses „wanton“ eng verwandt mit dem Wort wandern, das einst als zielloses Umherstreifen zum bloßen Selbstzweck, zur persönlichen Erbauung verstanden wurde.
Mag sein, dass sich in Zeiten von GPS-Tracking und Wander-Apps die Bedeutung des Begriffs gewandelt hat. Doch noch immer liegt der Reiz des Unterwegsseins, des Fortschritts, wenn man so will, darin, sich Neuem auszusetzen, nicht zu wissen, was einen hinter der nächsten Biegung erwartet, wie das Wetter in den nächsten Stunden wird, wohin einen der Weg überhaupt führt.
Nicht immer mögen die Entscheidungen, die man angesichts dieser Unwägbarkeiten trifft, im ersten Moment richtig erscheinen. Am Schluss bleibt jedoch die Gewissheit, etwas getan zu haben. Inmitten der mal großen, mal kleinen Veränderungen, die das Leben so mit sich bringt, selbst die Initiative ergriffen zu haben. Und wenn es bloß das Werfen einer Münze ist.
Mehr dazu
„Entscheidungen sind immer auch Chancen“
Von Zentralmatura bis PISA: Das kommt 2019!
Essay: Entscheiden Sie selbst!
Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 4.