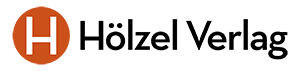Schwerpunkt
Essay: Marmeladen und andere Entscheidungen
Im Wirtschaftsleben kommt man an Entscheidungen nicht vorbei. Zu den meisten lassen wir uns mehr oder weniger sanft drängen. Die wichtigsten jedoch tragen kein Preiszetterl.
Ein Essay von Stefan Schlögl - 13. Februar 2019
Wirtschaft ist: permanente Entscheidung. Über Investitionen, die Preisgestaltung, die Entwicklung eines neuen Produkts, das Ersparte in Aktien oder Bitcoins anzulegen bis hin zur Entscheidung, bis zum Winterschlussverkauf zu warten oder doch spontan bei einem Rabattangebot zuzugreifen.
Doch bevor wir in die Welt der unendlichen Wahlmöglichkeiten eintauchen, gilt es noch, eine nicht unwesentliche Frage zu klären: Wer trifft eigentlich die besseren Entscheidungen, wenn es um Geld und Finanzen geht? Frauen oder Männer? Die Antwort lautet … Frauen.
Die benötigen dafür und den Ergebnissen einer Studie der kanadischen DeGroote School of Business zufolge zwar ein wenig länger, wägen aber gewissenhafter die Vor- und Nachteile ab und erzielen so langfristig bessere Ergebnisse.

Hunderte Gläser, unzählige Marken, noch mehr Geschmacksrichtungen. Ein Abwägungs-GAU. Eine Entscheidung muss her. Foto: shutterstock/Gurza
Eine andere Untersuchung belegt übrigens, dass Unternehmen mit einer höheren Frauenquote im Management eine um 42 Prozent höhere Umsatzrendite aufweisen. Bloß eine einzige weibliche Kraft in der Chefetage senkt das Risiko einer Insolvenz um 20 Prozent. Sie haben die Wahl, welche Schlüsse aus diesen Zahlen zu ziehen sind.
Der Marmeladen-Test
So leicht diese Entscheidung ist, so schwierig wird die Sache angesichts eines Supermarktregals voll Marmeladen-Gläser. Hunderte Gläser, unzählige Marken, noch mehr Geschmacksrichtungen. Ein Abwägungs-GAU, wenn man nicht blinden Routinen („Die schmeckt mir bis ans Ende meiner Tage“) folgt oder einfach stur zur billigsten greift.
Ein Team der Columbia Universität in New York erforschte, was Auswahlmöglichkeiten bei uns anrichten können: Sie boten Supermarktkunden kleine Marmelade-Kostproben an, einmal sechs Sorten, in einem weiteren Testlauf 24 Sorten. War das Angebot groß, probierten 60 Prozent der Angesprochenen eine der Marmeladen, ungleich mehr als bei der kleineren Auswahl.
Doch gerade die Tester der kleineren Auswahl kauften dann eher auch tatsächlich ein Glas. Sechs Mal öfter als jene, die vor der üppigen Sortenvielfalt standen. Kurzum: Das große Sortiment lockt uns an – überfordert uns aber gleichzeitig, wenn es darum geht, eine endgültige Kaufentscheidung zu treffen.
„Schluss mit selbst assemblierten Burgern, individuell gestylten Sneakern und aufgepimpten Barista-Kreationen (Welches Topping hätten S’denn gern?)“
Um uns von dieser Blockade zu befreien, haben Marketing und Werbung allerlei Anreize in ihre Shopping-Tempel eingebaut. Der wichtigste: Ein Wohlfühlambiente muss her. Denn wer länger bleibt, füllt Einkaufswägen, weiß die Forschung.
Also wird der Kunde nach dem Betreten gleich einmal abgebremst. Mittel der Wahl fürs erste Runterkommen ist die Obst- und Gemüsetheke. Da kann man betasten, riechen und gustieren – und verwandelt sich prompt vom gehetzten Feierabend-Shopper in einen gelassenen, souveränen Entscheider.
Von einigem, was Kaufhäuser an Stimulans und subtiler Manipulation bereithalten, hat man schon gehört: eine Idealtemperatur von 19 Grad, die Wegeführung gegen den Uhrzeigersinn, damit die rechte Hand, bei den meisten die dominante, ungehindert ins Regal greifen kann.
Phantasie ist alles
Sogenannte Blocker – aufgestellte Werbemittel oder Sonderangebotsstapel – bremsen uns immer wieder ab. Dinge des täglichen Bedarfs (Milch, Käse, Wurst) warten natürlich im hintersten Winkel, damit wir auch ja durch alle Regal-Schluchten müssen. Den leisen Ingrimm darüber dämpfen verlässlich flockige Powerrock-Balladen aus den Lautsprechern.
Ein relativ neuer Trick sind die sogenannten Themeninseln. Die sollen nämlich nichts weniger als unsere Phantasie anregen. Ein Frühstückstisch etwa, gedeckt mit Müsli, Geschirr, Obst, Säften und – natürlich – Marmeladen.
Gemütlich sieht das aus. So, wie wir uns selbst einen guten Morgen wünschen würden. Und schon steht man nicht nur mit einem Glas Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, sondern mit einem Gojibeeren-Müsli und ein paar schicken Schälchen an der Kasse.
„Der Kauf einer Digitalkamera kann die Synapsen zum Glühen bringen – vor allem wenn eine endlose Expedition durch Preisvergleichsportale ansteht.“
Richtig irrational wird das Ganze, wenn es um den Preis geht. Nur ein Beispiel: Was jeder persönlich für einen faires Angebot hält, hängt nicht von der Ratio ab, sondern von unserer Prägung, dem sogenannten Ankerpreis. Auf den greifen wir vor allem bei Produkten zurück, die wir relativ selten kaufen.
Wer bislang für ein Fernsehgerät rund 500 Euro ausgegeben hat und damit zufrieden war, wird sich auch in Zukunft an diesem Preis orientieren. Ein Modell um 1.000 Euro wirkt dann im Vergleich sündteuer, eines um 200 Euro kann eigentlich nur miese Billigware sein.

Bei jeder Kaufentscheidung wird das Gehirn zum Schauplatz eines sehenswerten Kampfs zwischen dem limbischen System und der Großhirnrinde, in der die Analysezentrale sitzt. Foto: shutterstock/Gurza
Dass sich seit dem letzen Kauf Preisgefüge und Leistungsangebot erheblich verändert haben, blenden wir zuerst einmal aus. Schließlich haben wir uns damals mit einer klugen, schlicht der richtigen Wahl belohnt. Und Menschen mögen Belohnungen – zumindest bis eingehende Recherchen neue Gratifikationen versprechen.
Vergleichen, vergleichen, vergleichen
Preis- und Produktvergleiche sind die Grundlage, um uns für eine Kaufentscheidung zu belohnen. Gleichzeitig wird das Gehirn zum Schauplatz eines sehenswerten Kampfs zwischen dem limbischen System, unserem emotionalen Zentrum und der Großhirnrinde, in der die Analysezentrale sitzt.
Der Kauf einer Digitalkamera kann da schon die Synapsen zum Glühen bringen – vor allem wenn eine schier endlose Expedition durch unzählige Online-Shops und Preisvergleichsportale ansteht. Gewissermaßen befeuert wird der Wettstreit der Gehirnareale durch unsere Angst vor der kognitiven Dissonanz, jenem negativen Gefühlszustand, der sich einstellt, wenn wir mit unvereinbaren Wahrnehmungen, Gedanken und Meinungen konfrontiert werden.
„Nur wenn wir wissen, was unsere eigenen Entscheidungen beeinflusst, ist es möglich, nicht nur einen Beruf, sondern auch eine Berufung zu finden.“
Der Arbeitskollege weist mit süffisantem Grinsen darauf hin, dass er die gleiche Kamera um zehn Euro günstiger erstanden hat? Samt Gratis-Speicherkarte selbstverständlich. Mehr bedarf es nicht, um eine Entscheidung, mit der man eigentlich glücklich war, in einen Fehlkauf umzudeuten.
Mit der Zahl der Optionen, die uns das Internet theoretisch und per Mausklick zur Verfügung stellt, wächst nun einmal die Gefahr, Fehler zu machen. Gut möglich, dass der Erfolg der „Zurück-zur“-Bewegung, das Besingen der „Neuen Einfachheit“, die frisch entdeckte Liebe zu Heimat und Ursprünglichkeit und der Vintage-Boom eine Gegenreaktion auf den globalen Optionismus ist.
Schluss mit selbst assemblierten Burgern, individuell gestylten Sneakern und aufgepimpten Barista-Kreationen (Welches Topping hätten S’ denn gern?). Danke, einfach Kaffee tut’s auch. Vor allem auf der abgelegenen Berghütte, in der sich die Speisen-Auswahl auf ein einziges Menü beschränkt. Und das bitte ist um Punkt 19 Uhr einzunehmen, danach Nachtruhe um 22 Uhr.
Kleine Entscheidungshelfer
Das Weglassen von Möglichkeiten als Ausdruck persönlicher Freiheit. Auch das ist eine Entscheidung. Aber nicht nur am Berg wird verknappt, um potenzielle Kunden aus der Für-und-wider-Schleife zu befreien. In den vergangenen Jahren ist ein neuer Dienstleistungszweig enstanden, der sich darauf spezialisiert hat, uns Entscheidungen abzunehmen.
„Curated Shopping“ heißt der Trend, aus dem eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle der jüngeren Zeit entstanden ist. Da gibt es Streaming-Dienste, die anhand des Feedbacks die eigene Playlist um neue Titel ergänzen, und schlaue Handy-Apps, die in allen erdenklichen und weniger erdenklichen Situationen eine Entscheidung anstoßen.
Oder Abo-Modelle, die Schluss machen mit den großen Fragen des Alltags: Was soll ich anziehen? Was soll ich kochen? Ist noch Marmelade im Kühlschrank? Von Kochboxen mit exakt abgepackten Mengen für jede einzelne Mahlzeit über Brotkörbchen und Gemüsekisten bis hin zu Kosmetikboxen reicht mittlerweile das Angebot.
„Entscheidungen sind nicht einfach. Aber sie machen uns individuell, sind Teil unserer Identität – vor allem als Berufstätige.“
Sogar Mode-Muffel, vor allem männliche, werden mithilfe fix und fertig zusammengestellter und vor die Tür gelieferter Outfits von Odysseen durch die Shopping-Malls befreit. Da spielt es schon fast keine Rolle, dass die Ware teils erheblich mehr kostet. Zeit und Energie zu sparen, sind stattdessen die neuen Hartwährungen in unserer beschleunigten Gesellschaft.
Ähnlich dienstbar sind die Bewertungen und Algorithmen in den einschlägigen Online-Portalen. Sie suchen auf Amazon einen neuen Krimi? Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch Folgendes angesehen.
Entscheidungsgrundlagen bleiben im Dunkeln
Im Urlaub erspart einem TripAdvisor die Diskussion, welches Restaurant nun besucht wird. Und auf Kununu, einem Portal, auf dem Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten, drängt sich der Brötchengeber kraft einer hohen Sterne-Bewertung ins Rampenlicht.
Welche Algorithmen, welche Methoden diesen Aussagen zugrunde liegen, bleibt jedoch oft im Dunkeln. Manchmal funktionieren diese Entscheidungshelfer famos, doch mitunter sitzt man im Zimmer eines hochgelobten Hotels und fragt sich: Und warum hat das jetzt eine Top-Bewertung?
Ja, wir lassen uns ziemlich leicht in unseren Kauf- und Investitionsentscheidungen beeinflussen. Forschungsergebnisse aus der Verhaltenspsychologie geben beredt darüber Auskunft.
Die Einstiegsfrage
Schwarmintelligenz, Feedback-Schleifen, Kuratoren und Smartphone-Apps können uns dabei unterstützen, eine möglichst gute Wahl zu treffen, Komplexität zu reduzieren und Fehler zu vermeiden. Auf uns als Individuen können auch sie nur bedingt Rücksicht nehmen, handelt es sich dabei bloß um „Relevanzen“ aus dritter Hand.
Tatsächlich gibt es einen enormen Unterschied zwischen dem, was man für wichtig hält beziehungsweise haben „muss“, und dem, was in Bezug auf die eigenen Erfahrungen und Interessen, das eigene Budget sowie auf die selbst gesteckten Ziele und Erwartungen tatsächlich relevant ist.
Entscheidungen sind nicht einfach. Aber sie machen uns individuell, sind Teil unserer Identität – vor allem in unserer anderen großen Rolle innerhalb des Wirtschaftslebens: als Berufstätige.

Schwarmintelligenz, Feedback-Schleifen, Kuratoren und Smartphone-Apps können uns dabei unterstützen, eine möglichst gute Wahl zu treffen. Foto: shutterstock/Gurza
„Was machst du eigentlich so?“ Dieser klassischen Einstiegsfrage in ein Gespräch sind unzählige Entscheidungen vorangegangen, die uns zu jenem Beruf verholfen haben, den wir gerade ausüben. Bei vielen wurden wir unterstützt und bestärkt, von Eltern, Lehrern und Freunden, auf andere, das zeigt die Sozialwissenschaft seit Jahrzehnten, haben wir kaum Einfluss.
So befördern nicht allein gute Noten, sondern vor allem das Einkommen und der Bildungsgrad der Eltern die Schulkarrieren ihrer Kinder. Die ergreifen, auch das belegen Forschungsergebnisse, besonders oft die Berufe, die auch Vater oder Mutter ausüben.
Antonia-Dorothea oder Jennifer?
Sogar der Vorname spielt eine Rolle. Wer hat das Zeug zur Harvard-Absolventin? Antonia-Dorothea oder Jennifer? Keine Sorge, Ihr Gefühl wird von einschlägigen Studien bestätigt, ändert aber nichts daran, dass eine Karriere nun einmal das Produkt von allerlei Zufällen und Fremdentscheidungen ist.
Ganz abgesehen davon, dass wir uns bei der Berufswahl nicht nur von Begabungen und hehren Zielen, sondern auch von der Höhe des Einstiegsgehalts sowie der Reputation und dem Bekanntheitsgrad eines Unternehmens leiten lassen. So viel zur Wahrheit.
Die andere Wahrheit lautet: Nur wer Angebote bekommt und Kompetenzen erwirbt, sei es in der Schule, im Elternhaus, im Leben allgemein, hat die Möglichkeit, den Einfluss dieser Faktoren so gering wie möglich zu halten – und sich tatsächlich auf seine persönlichen Entscheidungen zu fokussieren.
„Eine Entscheidung heißt wortwörtlich gemeint nichts anderes, als das Schwert aus der Scheide zu ziehen, aktiv zu werden, sich einer Aufgabe zu stellen.“
Es ist wie in dem oben erwähnten Supermarkt: Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, was unsere Entscheidungen beeinflusst – Routinen, Eigen- und Fremderwartungen, schrille Verheißungen, eine zu große oder eine zu kleine Auswahl –, ist es uns möglich, nicht nur einen Beruf, sondern auch eine Berufung zu finden. Es geht also nicht darum, WAS wir werden, sondern WER wir werden.
Das setzt Mut voraus, Mut, Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen, kurzum: Entschiedenheit. Die ist übrigens im Wortstamm des Verbs „entscheiden“ angelegt: Im Germanischen bezeichnet das Wort „skaipi“ zwei verbundene Holzplatten, die ein Schwert schützten.
Aktiv werden
Eine „Entscheidung“ heißt also wortwörtlich gemeint nichts anderes, als das Schwert aus der Scheide zu ziehen, aktiv zu werden, sich einer Aufgabe zu stellen. Denn nicht aufzustehen, keine Entscheidungen zu treffen, ist die denkbar schlechteste Wahl – was auch eine IMAS-Umfrage aus dem Jahr 2016 belegt.
Auf die Frage, welche Entscheidungen die Befragten rückblickend auf ihr bisheriges Leben bedauern würden, finden sich bei den häufigsten Antworten kaum Taten, die man am liebsten rückgängig machen würde. Bereut werden hingegen vor allem Entscheidungen, die nicht getroffen wurden: in der Schulzeit nicht alles gegeben zu haben. Nicht den Mut gehabt zu haben, seine Gefühle auszudrücken. Und: zu wenig an sich selbst geglaubt zu haben.
Literatur zum Thema
Jochen Mai: Warum ich losging, um Milch zu kaufen, und mit einem Fahrrad nach Hause kam: Was wirklich hinter unseren Entscheidungen steckt. dtv 2016.
Daniel Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken. Penguin Verlag 2016.
Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein: Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt. Ullstein 2010.
Daniel Ariely: Denken hilft zwar, nützt aber nichts: Warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen. Droemer Knaur 2008.
Gerd Gigerenzer: Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft. btb 2014.
Mehr
Essay: Entscheiden Sie selbst!
Nachgefragt: Wie Schüler und Lehrer Entscheidungen treffen
Handys im Unterricht: Mit oder ohne?
Offener Unterricht: Lernen fürs Leben
Lernbüro: „Jugendliche gehen endlich wieder gerne in die Schule“
Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 2/18